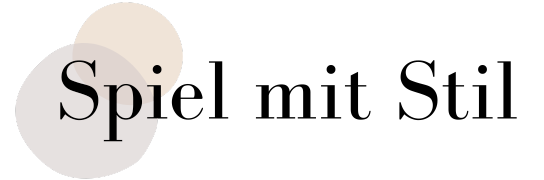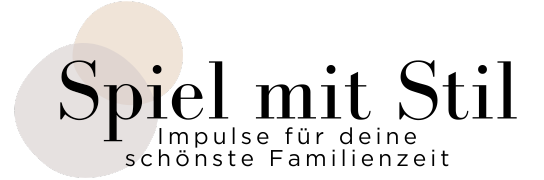In einer warmen Sommernacht, als Zikaden ihr ohrenbetäubendes Konzert spielten, erblickte Jennifers kleine Schwester das Licht der Welt. Ihre afro-lateinamerikanische Großmutter väterlicherseits rief voller Überraschung aus: „¡Mira, salió blanquita!“ – „Schau, sie ist weiß geworden!“. Diese Worte brannten sich tief in das Gedächtnis der damals sechsjährigen Jennifer Aguirre ein, einer Afro-Latinamerikanerin mit puerto-ricanischen und dominikanischen Wurzeln. Es war eine ihrer frühesten Begegnungen mit Colorism und Anti-Schwarzem-Denken, aber sicherlich nicht die letzte.
„Ich fragte meine Mutter, warum meine Großmutter das gesagt hatte. Sie hatte nicht wirklich die Worte, um es zu erklären. Es war ein Thema, das niemand wirklich ansprechen und diskutieren wollte“, erinnert sich Aguirre, die heute mit ihrer Familie in Südflorida lebt.
Colorism in der Familie – Ein schmerzhafter Kreislauf
Heute, als Mutter von drei Kindern, beobachtet Aguirre den Colorism in ihrer Familie erneut. Sie sieht, wie ihr jüngstes, hellhäutiges Kind gegenüber ihren beiden älteren, dunkelhäutigeren Geschwistern bevorzugt behandelt wird. „Ich glaube nicht, dass sie es merken, aber es ist offensichtlich in meinen Augen, und meine beiden älteren Kinder sehen es auch“, sagt sie.
Die Geschichte von Jennifer Aguirre ist kein Einzelfall. In vielen lateinamerikanischen Familien und Gemeinschaften ist Colorism, die Bevorzugung hellerer Hauttöne, tief verwurzelt. Diese Vorurteile haben ihren Ursprung in der Kolonialzeit und wirken bis heute nach. Sie beeinflussen nicht nur das soziale Leben, sondern auch die Identität und das Selbstwertgefühl der Betroffenen.
Laut dem Projekt zu Ethnizität und Rasse in Lateinamerika (PERLA) an der Princeton University leben in Lateinamerika schätzungsweise 130 Millionen Menschen afrikanischer Abstammung – das sind etwa 25 % der Gesamtbevölkerung.
Auch in den Vereinigten Staaten identifizierten sich im Jahr 2019 etwa 2,4 Millionen Menschen als schwarz und hispanisch. Doch diese Statistiken können trügerisch sein, da Vorurteile und die Auswirkungen von Anti-Schwarzem-Denken und Colorism in lateinamerikanischen Gemeinschaften nach wie vor weit verbreitet sind.
Eine Studie von Pew Research ergab beispielsweise, dass auf die Frage nach ihrer Rasse „nur 18 % der Afro-Latinos ihre Rasse oder eine ihrer Rassen als Schwarz bezeichneten“, während 39 % es immer noch vorzogen, sich als Weiß zu identifizieren. Darüber hinaus zeigt die Volkszählung von 2020, dass sich 45,3 Millionen Menschen hispanischer/lateinamerikanischer Herkunft selbst als „eine andere Rasse“ bezeichnen (entweder allein oder in Kombination mit einer anderen Rasse) – darunter möglicherweise auch Afro-Latinos, die sich eher mit Begriffen wie „Mestizo“, „Mulatte“ und „Trigueño“ identifizieren.
Die Gründe für diese uneindeutigen Statistiken sind komplex und wurzeln in einer Kolonialgeschichte, die im 16. Jahrhundert mit den Spaniern begann, die ein auf Hautfarbe basierendes Rassenkastensystem einführten – wobei afrikanische Nachkommen am unteren Ende der Kaste versklavt wurden. Die Sklaverei dauerte in Ländern wie Brasilien und Kuba zwar länger, wurde aber Mitte des 19. Jahrhunderts in Lateinamerika endgültig abgeschafft, doch viele schädliche Praktiken dieser Zeit blieben bestehen. Diese Geschichte sitzt so tief, dass schwarze Lateinamerikaner, afro-lateinamerikanische Personen und dunkelhäutige Latinos bis heute mit unnötigen Ungleichheiten und Rassismus zu kämpfen haben. Sogar, wie wir gesehen haben, in ihren eigenen Familien.
Verinnerlichter Rassismus – Wenn die eigenen Wurzeln schmerzen
Colorism manifestiert sich auf vielfältige Weise: von subtilen Bemerkungen über die Hautfarbe bis hin zu offener Diskriminierung bei der Jobsuche oder im Bildungssystem. Besonders schmerzhaft ist es, wenn diese Vorurteile innerhalb der eigenen Familie auftreten. Kinder, die aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligt werden, entwickeln oft ein geringes Selbstwertgefühl und kämpfen mit ihrer Identität.
Rosalia Rivera, eine salvadorianische Expertin für Konsensbildung und Missbrauchsprävention, erzählt eine erschütternde Geschichte: „Ich habe einen Cousin, der als ‚dunkelhäutig‘ gilt, und er heiratete eine schwarze Frau. Seine Mutter, die Cousine meiner Mutter zweiten Grades, verstieß ihn deswegen. Ihre Begründung war, dass er dann dunkelhäutigere Kinder haben würde und sie das Gefühl hatte, dass dies ihre Blutlinie noch mehr verdunkeln würde, als sie es ohnehin schon war.“ Rivera und ihre Mutter brachen daraufhin den Kontakt zur Mutter ihres Cousins ab.
„Es ließ meiner Mutter bewusst werden, dass sie sich uns gegenüber unbewusst ähnlich verhalten hatte, indem sie versuchte, uns [ihre Kinder] davon abzuhalten, zu lange in der Sonne zu sein und dadurch ‚zu dunkel‘ zu werden, als Folge ihres eigenen Traumas, in ihrer Jugend diskriminiert worden zu sein, weil sie dunkelhäutig war“, sagt Rivera.
Die Auswirkungen von Colorism können verheerend sein. Sie führen zu inneren Konflikten, Entfremdung und sogar zum Bruch von Familienbanden. Es ist ein Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist. Aber es gibt Hoffnung.

Familienbande: Gemeinsame Lesestunde
Wie können wir als lateinamerikanische und afro-lateinamerikanische Eltern beginnen, die rassistischen, coloristischen und Anti-Schwarzen-Einstellungen unserer Ältesten abzubauen? Wie können wir stärkere Grenzen setzen und dagegen in unseren Haushalten vorgehen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sprach ich mit Gloria Osborne-Sheeler, einer panamaischen Afro-Latinamerikanerin, LCSW, approbierten Psychotherapeutin und CEO und Gründerin von Glow In Therapy, Inc., einer virtuellen Privatpraxis.
Osborne-Sheeler betont, wie wichtig es ist, das Schweigen zu brechen und offen über Colorism zu sprechen. Es ist ein unbequemes Thema, aber nur durch ehrliche Gespräche können wir das Bewusstsein schärfen und Veränderungen bewirken. Es beginnt damit, sich selbst zu hinterfragen und die eigenen Vorurteile zu erkennen.
Wir müssen uns bewusst machen, dass Colorism ein Problem ist, das uns alle betrifft. Wir müssen lernen, die Schönheit in allen Hautfarben zu sehen und jede Form von Diskriminierung zu bekämpfen.
Die Psychotherapeutin Gloria Osborne-Sheeler ermutigt dazu, aktiv zu werden, insbesondere wenn es um die eigenen Kinder geht. Es beginnt mit der Beobachtung, wie Kinder auf die Unterschiede in Hautfarbe und Haarstruktur reagieren. Dies bietet eine gute Gelegenheit, um einfühlsame Gespräche zu führen, in denen erklärt wird, dass Vielfalt eine Bereicherung darstellt und niemand aufgrund seines Aussehens besser oder schlechter ist.
Es ist wichtig, den Kindern ein starkes Selbstwertgefühl zu vermitteln, das nicht von äußeren Faktoren abhängt. Sie sollen stolz auf ihre Wurzeln sein und sich nicht für ihre Hautfarbe schämen. Eltern können ihren Kindern helfen, indem sie ihnen positive Vorbilder präsentieren, die ihre Vielfalt widerspiegeln.
Wie Colorism Latine-Kinder beeinflusst
Ob durch Familienmitglieder, Medien oder Gleichaltrige – es gibt viele Möglichkeiten, wie Kinder Beispiele für Colorism sehen können. Und trotz dem, was Erwachsene denken, nehmen sie alles auf. „Es wird sich negativ auf das Zugehörigkeitsgefühl und die Identität eines Kindes auswirken, wenn es [Anti-Schwarze Rhetorik] von irgendjemandem hört“, sagt Osborne-Sheeler.
Dies kann letztendlich dazu führen, dass Afro-Latine-Kinder sich selbst in Dingen in Frage stellen, über die sie keine Kontrolle haben, wie z. B. Rasse, Hautfarbe und Haarstruktur. „Sie werden anfangen, sich anders, isoliert zu fühlen und höchstwahrscheinlich dazu neigen, ihre Unterschiede als etwas ‚Schlechtes‘ anzusehen, was dazu führen kann, dass Einzelpersonen ein fragmentiertes Gefühl des Seins entwickeln und in Frage stellen, wo sie hingehören, wie sie hineinpassen und wo sie akzeptiert werden“, sagt Osborne-Sheeler.
Dieser Kampf um die Identität wird für Afro-Latinos, die auch in schwarzen Gemeinschaften in den USA Ablehnung erfahren, noch schwieriger. „Etwas, das ich oft beim Aufwachsen erlebt habe, war das Gefühl, nicht Latina genug zu sein, um Latina zu sein, und nicht schwarz genug, um schwarz zu sein“, sagt Osborne-Sheeler. „Es gab keine Kästchen, die ich ankreuzen konnte, die mir das Gefühl gaben, Teil einer Gruppe zu sein.“
Produktive Gespräche über Hautfarbe führen
„Als Sozialarbeiterin neige ich eher dazu, mich zu Wort zu melden, wenn es eine Ungerechtigkeit gibt – oder wenn etwas einfach nicht richtig ist“, sagt Osborne-Sheeler. Auch wenn diese Gespräche schwierig sind, sind sie notwendig, um den Kreislauf des Rassismus zu durchbrechen. „Oft werden diese Überzeugungen veraltet und unbewusst von Generation zu Generation weitergegeben – niemand hinterfragt, warum dies überhaupt eine Überzeugung ist oder warum sie sie weiterhin aufrechterhalten“, sagt Osborne-Sheeler.
Sie schlägt vor, das Thema aus einer Neugierde heraus anzugehen, die Menschen, die Colorism erfahren, ermutigt, zu hinterfragen, woher diese Ideen kommen und warum die Person sie aufrechterhalten will.
„Es kann auch hilfreich sein, Familienmitglieder aufzuklären, indem man ihnen von den eigenen positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit oder Interaktion mit anderen People of Color – insbesondere schwarzen Menschen – berichtet.“ Darüber hinaus ermutigt sie Patienten, sanfte Korrekturen vorzunehmen, wenn sie hören, dass die Familie Urteile über andere fällt.
Eine weitere Möglichkeit, Colorism zu bekämpfen, ist es, Kindern ein kritisches Bewusstsein für die Medien zu vermitteln. Sie sollen lernen, rassistische Darstellungen zu erkennen und zu hinterfragen. Eltern können mit ihren Kindern über die fehlende Vielfalt in Filmen, Serien und Zeitschriften sprechen und ihnen alternative Medien zeigen, die ein realistischeres Bild der Gesellschaft vermitteln.
Grenzen gegenüber Familienmitgliedern wahren, die sich weigern, sich zu ändern
Wir dürfen bei keiner Art von Vorurteilen Komplizen bleiben, daher ist es laut Osborne-Sheeler wichtig, sich über die eigenen Überzeugungen und Werte im Klaren zu sein. „Wenn Sie das tun, wird es einfacher, bei Bedarf verbale und körperliche Grenzen gegenüber anderen zu setzen“, sagt sie. „Sich zu Wort zu melden und jemanden wissen zu lassen, dass Sie mit den Aussagen, die er gegenüber schwarzen Gemeinschaften macht, nicht einverstanden sind oder dass Sie seine Überzeugungen nicht unterstützen, sind Beispiele für das Setzen einer verbalen Grenze.“
Sie sagt auch, man solle die Leute wissen lassen, wenn sich etwas unangenehm oder enttäuschend anfühlt, wenn sie negative Aussagen machen. Bei Bedarf kann es sinnvoll sein, die Interaktionen mit denen einzuschränken, die weiterhin die eigenen Grenzen verletzen.
Es ist wichtig, sich selbst und seine Kinder vor negativen Einflüssen zu schützen. Das bedeutet, dass man sich von Menschen distanzieren muss, die rassistische oder coloristische Ansichten vertreten. Es ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig, um ein gesundes Umfeld für die Kinder zu schaffen.
Wie man reagiert, wenn ein Familienmitglied eine rassistische Aussage macht
In diesen unglücklichen Umständen ermutigt Osborne-Sheeler Eltern, ihre Grenzen in die Tat umzusetzen. Üben Sie eine klare Aussage für den Fall, dass diese Ereignisse eintreten könnten. Hier ist ein Beispiel, das sie teilt:
„Ich bin mit Ihren Überzeugungen nicht einverstanden und bitte Sie, diese Überzeugungen nicht vor meinen Kindern zu äußern.“
Es ist wichtig, eine altersgerechte Sprache zu verwenden und die Kinder an die Überzeugungen in Ihrem Zuhause zu erinnern, insbesondere wenn rassistische Schimpfwörter verwendet werden. „Bei Kindern im Grundschulalter können Eltern reagieren, indem sie anerkennen, dass das Schimpfwort ein böses Wort ist und dass es niemals in Ordnung ist, das Wort zu verwenden“, sagt Osborne-Sheeler. Wenn Kinder älter werden (Mittel- und Oberstufe), sollten Eltern weiterhin die Unangemessenheit des Schimpfworts diskutieren, aber auch einen historischeren Kontext für Schimpfwörter geben und wie und warum sie verwendet werden, um andere herabzusetzen.
Es ist wichtig, den Kindern zu erklären, warum bestimmte Aussagen verletzend sind und welche Auswirkungen sie haben können. Sie sollen lernen, Empathie zu entwickeln und sich in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen.
Kinder befähigen, Anti-Schwarzem-Denken anzuprangern
Die Aufklärung unserer Kinder über Colorism umfasst einige Schritte. Osborne-Sheeler schlägt Folgendes vor:
- Sprechen Sie über Hautfarbe
- Lesen Sie Bücher, die Vielfalt fördern
- Schauen Sie sich Fernsehsendungen und Filme an, die Vielfalt fördern
- Befähigen Sie Kinder, sich zu äußern, wenn sie Zeugen von Anti-Schwarzem-Denken werden
Wie bei den meisten Traumata braucht es Arbeit. „Bilden Sie die Familie weiter, führen Sie Gespräche, um Colorism anzusprechen, und korrigieren Sie das Verhalten“, sagt Osborne-Sheeler. Abschließend ermutigt sie Latinos, insbesondere Afro-Latinos, die direkt betroffen waren, in Therapie zu gehen, um vergangene Erfahrungen zu verarbeiten und die Veränderungen zu bewerten, die wir vornehmen müssen, um voranzukommen.
Die Reise zur Überwindung von Colorism ist ein Marathon, kein Sprint. Es erfordert Geduld, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder selbst zu hinterfragen. Aber es ist eine Reise, die sich lohnt – für uns selbst, für unsere Kinder und für eine gerechtere Gesellschaft.
Fazit
Colorism ist ein tief verwurzeltes Problem, das in vielen lateinamerikanischen Familien und Gemeinschaften existiert. Es ist wichtig, das Schweigen zu brechen und offen über Colorism zu sprechen, um das Bewusstsein zu schärfen und Veränderungen zu bewirken. Eltern können ihren Kindern helfen, indem sie ihnen ein starkes Selbstwertgefühl vermitteln, das nicht von äußeren Faktoren abhängt, und ihnen positive Vorbilder präsentieren, die ihre Vielfalt widerspiegeln. Es ist auch wichtig, Kindern ein kritisches Bewusstsein für die Medien zu vermitteln und ihnen zu erklären, warum bestimmte Aussagen verletzend sind. Die Bekämpfung von Colorism ist ein Marathon, kein Sprint, aber es ist eine Reise, die sich lohnt – für uns selbst, für unsere Kinder und für eine gerechtere Gesellschaft.
parents.com