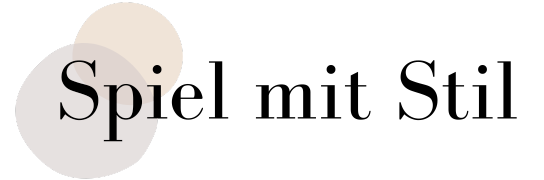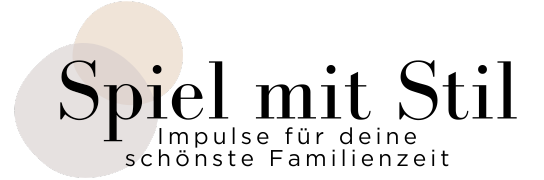Es war ein Moment, der sich für immer in das Gedächtnis einer Mutter einbrennen sollte. Ein winziges Wesen, hilflos und zerbrechlich, inmitten der kalten, technischen Umgebung einer Intensivstation. Die streichholzdünnen Ärmchen ausgestreckt, die Haut fast durchsichtig, ein Gewicht von kaum mehr als einem Pfund – so präsentierte sich das eigene Kind, viel zu früh aus dem sicheren Mutterleib gerissen. Eine Frühgeburt, ein Schock, der das Leben von Barbara Czermak, Autorin und Mutter, für immer veränderte.
Ein Blick in den Inkubator: Die ersten Momente
Die grellen Lichter der Neonatologie spiegelten sich in den gläsernen Wänden des Inkubators, während das Alarmschrillen der Überwachungsmonitore eine unheilvolle Symphonie spielte. Infusionsnadeln zierten die zarten Gliedmaßen, und ein Beatmungsschlauch nahm dem kleinen Wesen die Möglichkeit zu schreien. Es war ein Anblick, der Schmerz und Verzweiflung auslöste, ein Kampf ums Überleben, der kaum vorstellbar schien. Die Ohren noch weich, die Rippen zeichneten sich bei jedem Atemzug scharf ab – ein Bild, das sich tief in die Seele der Mutter einprägte. In diesem Moment begann eine Reise voller Ungewissheit, Hoffnung und unendlicher Liebe.
Fortschritte in der Neonatologie: Ein Hoffnungsschimmer
Obwohl der Anblick eines Frühchens auch heute noch erschütternd ist, haben sich die Überlebenschancen und die Lebensqualität dieser kleinen Kämpfer in den letzten Jahren erheblich verbessert. Professorin Orsolya Genzel-Boroviczeny, Leiterin der Neonatologie im Klinikum der Universität München-Innenstadt, betont, dass diese Fortschritte weniger auf neue Geräte als vielmehr auf eine veränderte Einstellung und größere Erfahrung zurückzuführen sind. Ein sanfterer Umgang mit den Winzlingen hat sich durchgesetzt, die „Känguruh-Methode“, bei der Eltern ihr Baby auf die Haut legen, gehört mittlerweile fast zum Standard in den Kliniken. Auch im Inkubator werden die Frühgeborenen so kuschelig wie möglich gelagert, um ihnen ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln.

Intimer Rückblick: Zwei Personen genießen die Ruhe am See
Die Bedeutung von Ruhe und Liebe
Inmitten der technischen Apparaturen und medizinischen Eingriffe erkannte Barbara Czermak, dass ihre Tochter vor allem eines brauchte: Ruhe und Liebe. Stundenlang saß sie auf einem Plastikstuhl neben dem Inkubator, beobachtet von fremden Blicken, und bettelte darum, ihr Kind füttern zu dürfen, wenn es vor Hunger weinte. Die Worte der Wiener Kinderärztin Marina Marcovich, die sie als Journalistin interviewte, hallten in ihrem Kopf wider: „Frühgeborene brauchen nur ein Minimum an Intensivmedizin. Sie brauchen vor allem viel Ruhe und Liebe, um sich ans Leben anpassen zu können.“
Die Liebe und Fürsorge der Eltern sind oft wichtiger als komplizierte Apparate.
Die Herausforderungen einer Frühgeburt
Eine Frühgeburt ist ein schwerer Start ins Leben, der mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist. Jedes Kind, das vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, gilt als Frühgeborenes. Je früher die Geburt, desto kritischer ist in der Regel der Zustand des Kindes. Mögliche Folgen einer extremen Frühgeburt können Lähmungen, Lungenrisse, Netzhautablösungen oder Erblindung sein. Auch die Intelligenz kann beeinträchtigt sein, und es können Wahrnehmungs- oder Verhaltensprobleme auftreten. Trotz dieser Risiken hat jeder Winzling eine Chance, sich gesund zu entwickeln.
Der medizinische Fortschritt und seine Schattenseiten
Leider werden immer mehr Frühchen geboren. In Deutschland kommen jährlich über 60.000 Kinder vorzeitig auf die Welt, das sind etwa neun Prozent aller Neugeborenen. Die Gründe für diesen Anstieg liegen ausgerechnet im medizinischen Fortschritt. So führen künstliche Befruchtungen zu mehr Zwillingsschwangerschaften, und das Alter der Schwangeren steigt. Zudem gibt es wirksamere Maßnahmen bei drohenden Fehlgeburten, sodass diese häufig in Frühgeburten enden. Auch Erkrankungen der Schwangeren, seelischer Druck oder eine Schwangerschaftsvergiftung können eine Frühgeburt auslösen. Die Hilflosigkeit gegenüber manchen Komplikationen während der Schwangerschaft, wie dem HELLP-Syndrom, bleibt bestehen.
Der Kampf ums Überleben: Eine Mutter in der Ausnahmesituation
Barbara Czermak erlebte die Ausnahmesituation einer Frühgeburt hautnah. Ihr Blutdruck stieg auf gefährliche Werte, Leber und Nieren drohten zu versagen, und die Ärzte fürchteten Krampfanfälle. Eine Woche lag sie im Krankenhaus, umgeben von Monitoren und dem Jubel über die Geburten gesunder Kinder. In dieser Zeit kämpfte sie nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das ihrer Tochter. Die Frage „Wird mein Baby leben?“ quälte sie Tag und Nacht.
Unterstützung für Eltern: Ein wichtiger Baustein
Sozialpädagogin Petra Hochecker betreut in der Münchner Abteilung von Professor Genzel-Boroviczeny Mütter und Väter in dieser Ausnahmesituation. Sie organisiert Haushaltshilfen, erklärt gesetzliche Regelungen und unterstützt im Papierkrieg. Vor allem aber hört sie zu, tröstet und baut auf. Denn viele Frühchen-Mütter machen sich schwere Vorwürfe, ihr Baby nicht neun Monate geschützt zu haben. Auch das Verhältnis von Eltern und Pflegepersonal kann angespannt sein, da gestresste Schwestern und eilige Ärzte auf verzweifelte und ungeduldige Eltern treffen. Eine gute Kommunikation und gegenseitiges Verständnis sind daher essenziell.
Die Bedeutung der richtigen Klinik
Neonatologe Michael Obladen ist überzeugt, dass jedes fünfte Frühchen, das bei der Geburt stirbt, noch leben könnte, wenn es im richtigen Haus zur Welt gekommen wäre. Er fordert, dass nur Perinatalzentren mit höchster Qualitätsstufe Frühgeborene versorgen dürfen. Denn in Kliniken mit wenig Erfahrung wird oft improvisiert, was lebensgefährlich für die Babys sein kann. Mütter sollten bei drohender Frühgeburt deshalb sofort eine Verlegung ins nächstgrößere Zentrum fordern.
Ein langer Weg: Cora kommt nach Hause
Drei Monate nach der Geburt durfte Cora endlich nach Hause. Doch der Start war alles andere als einfach. Sie schrie panisch, verzweifelt, Tag und Nacht. Jedes Geräusch ließ sie zusammenfahren, und sie schlief nie länger als zwanzig Minuten am Stück. Hinzu kamen Unterernährung, eine Trinkstörung, Panikattacken und ständige Krankheiten. Barbara Czermak verbrachte unzählige Nächte in Notaufnahmen und viele Wochen in Kliniken. Die Partnerschaft zerbrach an der Belastung. Frühcheneltern stehen oft unter enormem Druck, und die Trennungsrate ist hoch.
Langzeitfolgen: Eine Herausforderung für die ganze Familie
Frühchen sind auch Jahre nach der Geburt oft keine einfachen Kinder. Körperliche Probleme oder seelische Notstände können die Eltern an ihre Grenzen bringen. Frühgeborene neigen dazu, Träumer zu werden, die in der Schule Probleme haben. Einige haben Schwierigkeiten, allein zu bleiben, oder machen jeden Schmerz mit sich alleine aus. Für Eltern ist das schwer, vor allem, weil so viel Herzblut und Sorge in diesen Kindern steckt.
Ein Happy End: Cora wird groß
Trotz aller Schwierigkeiten hat Barbara Czermak nie aufgegeben. Sie kämpfte für ihre Tochter, gab ihr all ihre Liebe und Unterstützung. Und ihr Einsatz hat sich gelohnt. Cora ist heute 13 Jahre alt, gesund, hübsch und klug. Sie besucht die siebte Klasse eines Gymnasiums und hat viel erreicht. Ein Happy End, das Mut macht und zeigt, dass Frühchen trotz aller Widrigkeiten ein erfülltes Leben führen können.
Fazit
Die Geschichte von Barbara Czermak und ihrer Tochter Cora ist ein bewegendes Zeugnis über die Herausforderungen und Freuden einer Frühgeburt. Sie zeigt, wie wichtig medizinischer Fortschritt, liebevolle Betreuung und die unermüdliche Unterstützung der Eltern sind, um Frühchen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Trotz aller Risiken und Schwierigkeiten können Frühgeborene ein gesundes und erfülltes Leben führen. Es erfordert viel Geduld, Kraft und Liebe, aber der Einsatz lohnt sich. Die Geschichte von Cora macht Mut und gibt allen Eltern von Frühchen die Hoffnung, dass auch ihr Kind eines Tages strahlend und gesund vor ihnen stehen wird.
Eltern.de