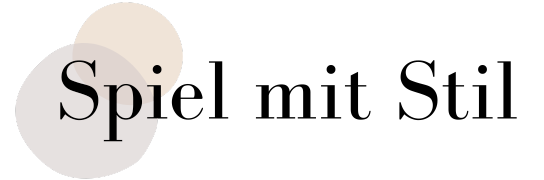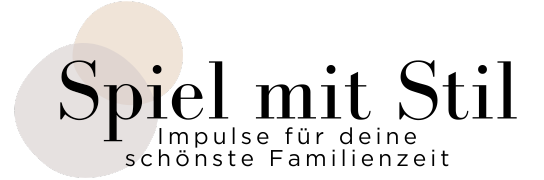Der Wunsch, dem eigenen Kind die Welt zweisprachig zu eröffnen, ist ein hehres Ziel. Viele Eltern träumen davon, ihren Kindern die Vorteile der Bilingualität mit auf den Weg zu geben. Doch was, wenn dieser Traum auf unerwartete Hindernisse stößt und sich der erhoffte Erfolg nicht einstellt? Was, wenn das Kind in der Zweitsprache einfach nicht „mitzieht“? Diese Fragen quälen viele Mütter, die sich nichts sehnlicher wünschen, als ihrem Kind diese zusätzliche Fähigkeit zu vermitteln. Der Weg zur zweisprachigen Erziehung kann steinig sein, voller Stolperfallen und unerwarteter Wendungen. Es ist eine Reise, die viel mehr erfordert als nur gute Vorsätze und den gelegentlichen Besuch eines Sprachkurses.
Der steinige Weg zur Bilingualität
Die Vorstellung ist so verlockend: Das Kind wächst ganz natürlich mit zwei Sprachen auf, wechselt mühelos zwischen ihnen und profitiert ein Leben lang von den Vorteilen der Bilingualität. Doch die Realität sieht oft anders aus. Eltern, die selbst nicht Muttersprachler sind, stoßen schnell an ihre Grenzen. Der Alltag ist vollgepackt mit Verpflichtungen, die Zeit für gezielte Sprachförderung fehlt, und die eigenen Sprachkenntnisse sind vielleicht doch nicht so gut, wie man dachte. Schnell macht sich Frustration breit, und das Gefühl, zu scheitern, nagt am Selbstbewusstsein. Hinzu kommt der Druck von außen: Verwandte, Freunde oder Bekannte, die scheinbar mühelos zweisprachige Kinder großziehen, oder gut gemeinte Ratschläge, die eher verunsichern als helfen. Die Reise zur Bilingualität kann zu einem emotionalen Minenfeld werden, in dem sich Eltern schnell verloren und überfordert fühlen.
Doch es gibt Hoffnung! Die Erziehung zur Zweisprachigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht nicht darum, von Anfang an perfekt zu sein, sondern darum, einen Weg zu finden, der zum eigenen Kind, zur eigenen Familie und zum eigenen Lebensstil passt. Es geht darum, realistische Erwartungen zu haben, sich Unterstützung zu suchen und die Freude an der Sprache und der Kultur in den Vordergrund zu stellen.

Sprachen lernen leicht gemacht: Mit spielerischen Apps und der Unterstützung der Familie wird Bilingualität zum Kinderspiel.
Die Macht der Planung und der richtige Zeitpunkt
Diandra Morse, eine anerkannte Expertin für bilinguale Erziehung und Gründerin von Bilingual Playdate, betont, dass die erfolgreiche Erziehung zur Zweisprachigkeit mehr als nur ein paar spontane Sprachlektionen erfordert. Es ist ein Prozess, der sorgfältige Planung und kontinuierliche Anstrengung erfordert. Viele Eltern gehen davon aus, dass es ein Kinderspiel wird, wenn sie selbst mehrere Sprachen sprechen oder in einer bilingualen Umgebung leben. Doch die Realität sieht oft anders aus. Die größte Hürde sind oft die eigenen, unrealistischen Erwartungen und die mangelnde Vorstellung davon, was es wirklich bedeutet, ein Kind zweisprachig zu erziehen. Es reicht nicht, sich vorzunehmen, regelmäßig spanische Videos anzuschauen oder das Kind zu einem Wochenendkurs anzumelden. Es braucht einen klaren Plan, eine konsequente Umsetzung und die Bereitschaft, Zeit, Energie und möglicherweise auch Geld zu investieren. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die bilinguale Erziehung eine zusätzliche Aufgabe ist, die neben all den anderen elterlichen Pflichten bewältigt werden muss.
Die Planung sollte folgende Punkte beinhalten:
- Festlegung von Zielen: Was soll das Kind in der Zweitsprache erreichen?
- Erstellung eines Zeitplans: Wann und wie oft wird die Zweitsprache in den Alltag integriert?
- Auswahl von Materialien und Ressourcen: Welche Bücher, Spiele, Apps oder Kurse sind geeignet?
- Suche nach Unterstützung: Gibt es andere Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden? Kann man sich professionelle Hilfe suchen?
Es ist wichtig zu erkennen, dass die bilinguale Erziehung kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Es geht nicht darum, von Anfang an perfekt zu sein, sondern darum, einen Weg zu finden, der zum eigenen Kind, zur eigenen Familie und zum eigenen Lebensstil passt.
Der Kampf mit den Erwartungen
Eine der größten Herausforderungen bei der bilingualen Erziehung ist der Umgang mit den Erwartungen – sowohl den eigenen als auch denen anderer. Schnell kommt es zu Situationen, in denen man sich rechtfertigen muss, warum das Kind die Zweitsprache (noch) nicht fließend spricht. Besonders schmerzhaft ist es, wenn diese Kritik von der eigenen Familie kommt, die vielleicht selbst Muttersprachler ist und die Erwartung hat, dass die jüngere Generation die Sprache ebenfalls beherrscht. Der Druck, diesen Erwartungen gerecht zu werden, kann enorm sein und zu Schuldgefühlen und Selbstzweifeln führen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass jede Familie und jedes Kind anders ist und dass es keinen allgemeingültigen Weg zur Bilingualität gibt. Es ist auch wichtig, sich von dem gesellschaftlichen Druck zu befreien, der oft vermittelt, dass „in Amerika nur Englisch gesprochen werden sollte“.
Morse rät dazu, realistische Erwartungen an sich selbst zu stellen und sich nicht von negativen Kommentaren entmutigen zu lassen. Sie betont, wie wichtig es ist, sich mit anderen Familien auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen machen, und sich professionelle Unterstützung zu suchen. Es gibt Experten, die sich auf die Erhaltung von Familiensprachen und die bilinguale Entwicklung von Kindern spezialisiert haben und wertvolle Ratschläge und Unterstützung bieten können. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Weg zur Bilingualität nicht immer geradlinig verläuft und dass es Rückschläge geben kann. Wichtig ist, nicht aufzugeben und den Fokus auf die positiven Aspekte der Bilingualität zu richten.
Die Kinder als Wegweiser
Manchmal ist es hilfreich, die eigenen Erwartungen loszulassen und den Kindern die Führung zu überlassen. Anstatt zu versuchen, ihnen die Zweitsprache aufzuzwingen, kann man sie spielerisch und ungezwungen in den Alltag integrieren. Das können Lieder, Filme, Spiele oder Bücher in der Zweitsprache sein. Wichtig ist, dass es den Kindern Spaß macht und sie die Sprache mit positiven Erlebnissen verbinden. Oftmals nehmen Kinder mehr auf, als man denkt. Sie hören den Eltern oder anderen Familienmitgliedern zu, wenn sie die Zweitsprache sprechen, und lernen ganz nebenbei Vokabeln und Redewendungen. Diese passiven Sprachkenntnisse können später, wenn das Kind älter ist und sich aktiv mit der Sprache auseinandersetzt, eine wertvolle Grundlage bilden.
Folgende Tipps können helfen, die Zweitsprache spielerisch in den Alltag zu integrieren:
- Gemeinsames Singen von Liedern in der Zweitsprache: Das macht Spaß und fördert das Sprachgefühl.
- Anschauen von Filmen oder Serien in der Zweitsprache: Am besten mit Untertiteln, um das Verständnis zu erleichtern.
- Spielen von Spielen in der Zweitsprache: Das können Brettspiele, Kartenspiele oder auch Online-Spiele sein.
- Lesen von Büchern in der Zweitsprache: Am besten altersgerechte Bücher mit vielen Bildern.
- Kochen von Gerichten aus dem Land, in dem die Zweitsprache gesprochen wird: Das verbindet Sprache mit Kultur und Genuss.
Die Autorin des Originalartikels erlebte eine positive Überraschung, als ihre Tochter in der Mittelstufe Spanisch als Fremdsprache wählte und mit Begeisterung lernte. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen all die Jahre über aufmerksam zugehört hatte, wenn die Familie Spanisch sprach, und so unbewusst einen Grundstock an Sprachkenntnissen erworben hatte. Dies zeigt, dass auch wenn es manchmal so scheint, als würde die bilinguale Erziehung nicht fruchten, die Kinder dennoch viel aufnehmen und später davon profitieren können.
Die Verbindung als Schlüssel zur Bilingualität
Morse betont, dass die Verbindung der Schlüssel zur Bilingualität ist. Es geht darum, den Kindern ein Gefühl der Zugehörigkeit zu der Kultur und den Menschen zu vermitteln, die die Zweitsprache sprechen. Das kann durch Reisen in das entsprechende Land geschehen, durch den Besuch von kulturellen Veranstaltungen oder durch den Kontakt zu Muttersprachlern. Wichtig ist, dass die Kinder die Sprache nicht nur als etwas sehen, das sie lernen müssen, sondern als etwas, das sie mit ihrer Familie, ihrer Geschichte und ihrer Identität verbindet. Die Autorin des Originalartikels erkannte, dass all die Familienfeiern mit lateinamerikanischer Musik und Gesprächen, die fließend zwischen Englisch und Spanisch wechselten, ihrer Tochter ein Gefühl der Verbundenheit mit der Kultur vermittelt hatten. So hatte das Mädchen die Sprache ganz nebenbei im Laufe ihrer Kindheit aufgeschnappt.
Eltern, die ihre Kinder bilingual erziehen möchten, sollten also nicht nur auf Sprachkurse und Vokabeltrainer setzen, sondern auch auf die Kraft der Verbindung. Sie sollten ihren Kindern die Möglichkeit geben, die Kultur und die Menschen kennenzulernen, die die Zweitsprache sprechen. Sie sollten ihnen Geschichten erzählen, mit ihnen kochen, Musik hören und gemeinsam feiern. Denn am Ende ist es die Liebe zur Sprache und zur Kultur, die Kinder dazu motiviert, sie zu lernen und zu sprechen.
Fazit: Bilingualität ist mehr als nur Vokabeln lernen
Die bilinguale Erziehung ist ein anspruchsvolles, aber lohnendes Unterfangen. Es erfordert Planung, Geduld, realistische Erwartungen und die Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse der Kinder einzustellen. Es geht nicht darum, Perfektion zu erreichen, sondern darum, einen Weg zu finden, der zur eigenen Familie passt und die Freude an der Sprache und der Kultur in den Vordergrund stellt. Es ist wichtig, sich von dem Druck von außen zu befreien und sich auf die eigenen Ziele zu konzentrieren. Kinder lernen oft mehr, als wir denken, und die Verbindung zur Sprache und Kultur ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Durch spielerische Aktivitäten, kulturelle Erlebnisse und den Kontakt zu Muttersprachlern kann man die Kinder auf ihrem Weg zur Bilingualität unterstützen und ihnen die vielen Vorteile dieser Fähigkeit ermöglichen. Und vielleicht erlebt man ja auch die positive Überraschung, dass die Kinder die Sprache ganz von alleine lernen, weil sie sich mit ihr verbunden fühlen.
parents.com