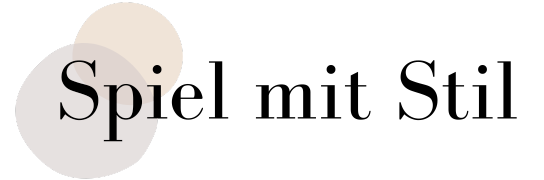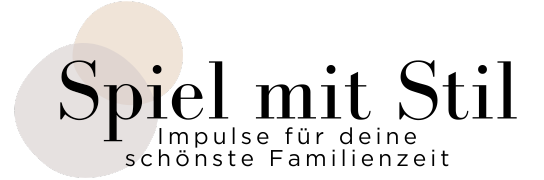In dem Moment, als der Arzt verkündete: „Es wird ein Mädchen!“, malte ich mir in den glühendsten Farben aus, wie ich meine Tochter zu einer selbstbewussten, unabhängigen Frau erziehen würde, die sich von niemandem etwas vorschreiben lässt. Ich wollte ihr die Welt zu Füßen legen, ihr zeigen, dass sie alles erreichen kann, was sie sich in den Kopf setzt. Doch dann kam die Realität – und sie hatte rosa Schleifchen im Haar.
Die rosarote Realität
Es dauerte nicht lange, da fand ich meine kleine Prinzessin inmitten eines Meeres aus Glitzer, Verkleidungskisten und dem unbändigen Wunsch, eine Märchenfigur zu sein. Die ältere Tochter liebte es, sich zu verkleiden, mit Tennissocken das Bustier auszustopfen und mit hoher Stimme zu fragen: „Naaain, meine Liebe?“. Und die Jüngere tat es ihr begeistert gleich. Bei Wettrennen gab sie sofort auf, wenn ein anderes Kind die Nase vorn hatte. War das mein Plan von bedingungsloser Selbstverwirklichung? War das die viel beschworene Gendergerechtigkeit, für die ich mich so leidenschaftlich einsetzen wollte? Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Paralleluniversum gelandet, in dem Klischees an jeder Ecke lauerten und meine hochgesteckten Ideale ins Wanken brachten.
Während meines Studiums der Sexualwissenschaften wurde mir immer bewusster, wie tief Ungleichheiten in unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Jedes Seminar öffnete mir die Augen für neue Facetten der Genderproblematik, doch gleichzeitig fühlte ich mich als Mutter zunehmend überfordert. Wie sollte ich all die Erkenntnisse in meinem Alltag umsetzen, wenn ich doch selbst in einem traditionellen Rollenmuster gefangen war? Mein Mann ging einer Vollzeitbeschäftigung nach, während ich mich teilzeitflexibel um Haushalt und Kinder kümmerte. War es nicht genau diese Verteilung, die dazu beitrug, dass meine Töchter in stereotype Verhaltensweisen abdrifteten?
Woher kommen die Klischees?
Ich begann, mich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Geschlechterklischees überhaupt entstehen. Warum greifen Kinder so bereitwillig auf vorgefertigte Rollenbilder zurück, obwohl wir als Eltern doch so bemüht sind, ihnen alle Möglichkeiten offenzuhalten? Im Studium lernte ich, dass Kinder schon in jungen Jahren lernen, zwischen typisch männlichen und weiblichen Verhaltensweisen zu unterscheiden. Sie beobachten ihre Umwelt, ahmen nach und ordnen sich selbst in die entsprechenden Schubladen ein. Das gibt ihnen Orientierung, aber es schränkt sie auch ein. Meine Schwiegermutter, eine ehemalige Grundschullehrerin, hatte schon in den 70er Jahren versucht, Geschlechterklischees entgegenzuwirken, indem sie neutrales Spielzeug und Kleidung förderte. Doch der Kampf gegen die allgegenwärtige Farben-, Zonen- und Thementrennung schien aussichtslos.
Mit etwa vier oder fünf Jahren verfestigt sich bei Kindern das Gefühl, ein Junge oder ein Mädchen zu sein. Dazuzugehören wird zum obersten Gebot. Doch was passiert, wenn ein Kind nicht ins Bild passt? Was, wenn es sich nicht mit den traditionellen Rollenbildern identifizieren kann? Viele Kinder spüren schon früh, dass sie anders sind, dass sie nicht dem Mainstream entsprechen. Einige verlieben sich ins gleiche Geschlecht, andere hadern mit ihrem biologischen Geschlecht. Ich habe viele Geschichten von Menschen gehört, die quer zum Mainstream lieben und leben, und mir wurde klar, wie wichtig es ist, nicht sorglos mit heterosexuellen Standards und dem Wort „normal“ umzugehen. Denn in jedem Umfeld gibt es ein Kind, das sich nicht im Mainstream entwickelt – und manchmal ist es sogar das eigene.

Kindliche Rollenspiele: Ein Mädchen als Fee und ein Junge als Ritter in einer Szene voller Fantasie und Abenteuer. Die warmen Farben und die dynamischen Posen unterstreichen die bezaubernde Welt der Kinder.
Die Rollenspiele meiner Töchter, so erkannte ich, waren ein Spiegelbild der Klischees, die sie in ihrem Umfeld und in den Medien wahrnahmen. Sie spielten mit den Extremen, um die Geschlechterrollen zu erforschen und sich in der Welt der Erwachsenen zurechtzufinden. Sie wollten hineinpassen, wie die Großen sein, besonders, Star, Prinzessin, Held, Kämpfer. Es war ein ganz natürlicher Prozess, auch wenn er manchmal frustrierend war. Und so kam ich zu folgender Erkenntnis:
Die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen ist ein lebenslanger Prozess, der uns immer wieder dazu zwingt, unsere eigenen Vorstellungen und Erwartungen zu hinterfragen.
Im Sexualwissenschafts-Studium wurde die Selbstreflexion großgeschrieben. Ich erinnerte mich daran, wie faszinierend es war zu wissen, dass da bald eine Brust wachsen würde, wo es jetzt noch flach war. Wie schön „sich schön machen“ war, übrigens für Mädchen und Jungen. Meine genervte Reaktion heute sagte also mehr über mich aus als über meine Kinder. Denn am Ende meiner Unisex-Zeit (also als sich mein Körper mit zwölf Jahren zu runden begann) fühlte ich mich, als würden mir die Flügel gestutzt, „das macht eine junge Frau nicht“: Solche Sätze hörte ich damals öfter. Von meinem Vater. Meinen Verwandten. Und plötzlich wurde das Geschlecht ein Käfig, Weiblichkeit Schwäche. Zum Glück ist das für unsere Kinder anders.
Marcus Thieme, Mitarbeiter im Arbeitsbereich „Sexualerziehung und Gender“ am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, bestätigte mir, dass unsere Gedanken zur Geschlechtererziehung eng mit unseren eigenen Erfahrungen verknüpft sind: „Wenn wir überlegen, was richtig männlich und richtig weiblich ist, sind wir doch sofort bei der eigenen Identität als Mann oder Frau.“ Viele Vorstellungen dazu haben wir von unseren Eltern mitbekommen: „Wie sehr wir davon geprägt sind, bemerken wir oft erst in der Kindererziehung oder in der Partnerschaft“, so Thieme. Und dann reiben wir uns am Partner – und an den eigenen Idealen.
Es geht auch um mich
Mein Ideal ist die Geschlechtergerechtigkeit. Doch tief in mir fühle ich mich trotzdem als „Frau und Mutter“ verantwortlicher für das Emotionale und das Soziale als mein Mann. Das macht oft glücklich. Und ist gleichzeitig frustrierend, weil wenig anerkannt. Und oft schlecht bezahlt. Dabei haben auch wir Frauen die Care-Arbeit nicht in unseren Genen. Und sie ist längst keine Privatangelegenheit, sondern eine große gesellschaftliche Frage geworden. Verflixt, hier geht es um mehr als Äußerlichkeiten. Auch um mehr als Bagger und Puppen.
Beim Plaudern mit Annika Arens, Sexualpädagogin bei pro familia Hamburg, kam noch ein guter Hinweis: „Häufig erkennen wir eher die geschlechtsstereotypen Verhaltensweisen von Kindern an als die, die nicht ins Erwartbare passen“, so die Expertin für sexuelle Bildung im Grundschulalter. „Eltern staunen immer, wenn ich sage: Damit kann ihr Kind nur die Hälfte seiner Fähigkeiten entwickeln.“ Stimmt. Meine jüngere Tochter etwa ist so energisch und körperlich, dass ich mich beim Gedanken ertappe: „Ganz schön ruppig für ein Mädchen.“ Würde ich über einen Jungen denken: Wow, ein Macher? Da sollte ich genauer hinsehen.
Und noch eine Frage, die ich mir gestellt habe: Haben es Jungs leichter, wenn es um die Geschlechtsrollen geht? Haben sie nicht! Im Gegenteil: Für sie ist der Grat noch schmaler: Denn während wilde Mädchen noch als burschikose Räubertöchter durchgehen, gibt es für Jungs, die ruhig und empfindsam sind, kaum Vorbilder. Es ist wichtig, Jungen den Raum zu geben, ihre Gefühle auszuleben und sich von traditionellen Männlichkeitsbildern zu befreien. Denn auch sie leiden unter den engen Grenzen, die ihnen die Gesellschaft auferlegt.
Inzwischen bin ich diplomierte Sexualwissenschaftlerin, werkele an Buch und Beratung für Eltern (www.lieben-lernen.info) und befrage und erweitere als Mensch und Mutter mein Bewusstsein. Mein konkretes Ziel: Menschen und Verhaltensweisen möglichst wenig in Kategorien einordnen, nicht gut oder schlecht „für ein Mädchen“ oder „für einen Jungen“ denken. Das wird den Kindern nicht gerecht, sie sind 100 Prozent Mensch, nicht nur 50 Prozent Mädchen oder Junge.
Wie kommen wir weiter?
Die Reise zur geschlechtergerechten Erziehung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist ein ständiges Hinterfragen, Reflektieren und Anpassen. Es bedeutet, sich von alten Denkmustern zu verabschieden und neue Wege zu gehen. Es bedeutet, Kinder in ihrer Individualität zu stärken und ihnen den Raum zu geben, sich frei zu entfalten – unabhängig von Geschlechterklischees. Es bedeutet, Vorbilder zu sein, die Vielfalt leben und Toleranz fördern. Und es bedeutet, sich selbst nicht zu vergessen, die eigenen Bedürfnisse zu respektieren und für die eigenen Rechte einzustehen. Denn nur wenn wir selbst in Balance sind, können wir unseren Kindern ein gutes Vorbild sein.
Darum hier eine Botschaft an dich, meine liebe, aus dem Ultraschall herausgewachsene, jetzt schon 14-jährige Tochter: Nie wieder werde ich sagen: „Du wirfst deine Handball-Tore aber gut – für ein Mädchen.“ Denn das verniedlicht und relativiert. Nein, meine Tochter, du wirfst supergut. Punkt. Deine Mutter
Fazit
Die geschlechtergerechte Erziehung ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, das uns als Eltern immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Es geht darum, Kinder in ihrer Individualität zu stärken, sie von Geschlechterklischees zu befreien und ihnen den Raum zu geben, sich frei zu entfalten. Es geht darum, Vorbilder zu sein, die Vielfalt leben und Toleranz fördern. Und es geht darum, sich selbst nicht zu vergessen, die eigenen Bedürfnisse zu respektieren und für die eigenen Rechte einzustehen. Nur wenn wir selbst in Balance sind, können wir unseren Kindern ein gutes Vorbild sein und sie auf ihrem Weg zu selbstbewussten und unabhängigen Persönlichkeiten begleiten. Es ist ein lebenslanger Prozess, der uns immer wieder dazu zwingt, unsere eigenen Vorstellungen und Erwartungen zu hinterfragen. Aber es ist auch eine Chance, die Welt ein Stückchen besser zu machen – für unsere Kinder und für uns selbst.
Eltern.de