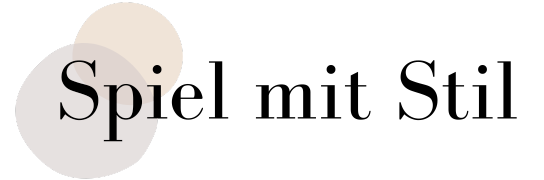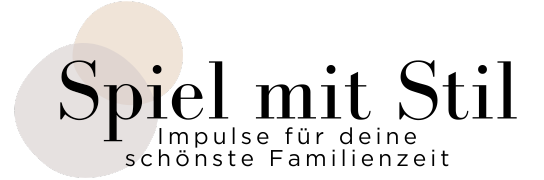Der Schulhof, ein Ort voller Möglichkeiten, Freundschaften und spielerischer Entdeckungen. Doch für manche Kinder wird er zum Schauplatz schmerzhafter Erfahrungen, geprägt von Ausgrenzung und rassistischen Beleidigungen. Der Hashtag #MeTwo hat bereits 2018 auf die weit verbreitete rassistische Diskriminierung in Deutschland aufmerksam gemacht. Doch die Realität, mit der sich Kinder und ihre Familien im Jahr 2024 konfrontiert sehen, zeigt, dass sich noch immer erschreckend wenig geändert hat.
Der tägliche Spießrutenlauf: Rassistische Beleidigungen als trauriger Alltag
„Du bist ja so braun wie Schokolade!“, „Hey, Sushi!“, „Schlitzauge!“, „Geh doch zurück in dein Land!“ – diese und ähnliche Schmähungen sind für Kinder mit Migrationshintergrund bittere Realität. Die verbale Gewalt entlädt sich oft in unbeobachteten Momenten, wenn keine Lehrkräfte in der Nähe sind. Das macht es den betroffenen Kindern besonders schwer, sich zu wehren. Hinterher will es niemand gewesen sein, und erzwungene Entschuldigungen wirken wie ein schwacher Trost. Der 12-jährige Kim*, der in Kambodscha geboren wurde und bei seiner deutschen Adoptivfamilie aufwächst, hat resigniert: „Ich sag das den Lehrern gar nicht mehr. Die machen eh nichts. Und hinterher wird es nur noch schlimmer!“ Seine Worte sind ein erschütterndes Zeugnis von Ohnmacht und fehlendem Schutz.
Die subtile und offene Diskriminierung, die diese Kinder erfahren, nagt an ihrem Selbstwertgefühl und untergräbt ihr Vertrauen in die Gesellschaft. Es ist, als ob sie ständig einen unsichtbaren Rucksack voller Vorurteile und negativer Zuschreibungen mit sich herumtragen müssten. Dies beeinträchtigt nicht nur ihre schulische Leistung, sondern auch ihre psychische Gesundheit und ihr soziales Wohlbefinden. Als Mütter ist es unsere Pflicht, diese Kinder zu stärken und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Wir müssen eine Umgebung schaffen, in der Vielfalt als Bereicherung gefeiert wird und in der Rassismus keinen Platz hat.

Einsamkeit auf dem Schulhof – ein Kind im Fokus
Die Wiederkehr der Vergangenheit: Wenn Stereotypen die Kindheit überschatten
Thanh Nguyen, heute 40 Jahre alt, musste ähnliche Erfahrungen bereits in seiner eigenen Kindheit machen. Umso schockierter ist er, dass seine dreijährige Tochter in der Kita mit denselben Stereotypen konfrontiert wird, die ihn einst so verletzt haben. Als seine Tochter arglos ein Fingerspiel mit dem Text „Ching, chang, chong, Chinese im Karton!“ sang, wurde Thanh mit seiner eigenen schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert. Die Erzieherinnen zeigten wenig Verständnis für seine Einwände und wiesen darauf hin, dass „das doch jedes Kind“ sage. Diese Reaktion verdeutlicht die fehlende Sensibilität für die tiefen Wunden, die rassistische Äußerungen hinterlassen können und die Notwendigkeit, Kinder frühzeitig für Vielfalt und Inklusion zu sensibilisieren.
Es ist wichtig, dass wir als Eltern und Erziehungsberechtigte eine aktive Rolle dabei spielen, solche Stereotypen zu entlarven und unseren Kindern zu vermitteln, dass jeder Mensch einzigartig ist und unabhängig von seiner Herkunft oder seinem Aussehen respektiert werden muss. Indem wir offen über Rassismus sprechen und Vorurteile hinterfragen, können wir dazu beitragen, eine tolerantere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Kinder in einer Welt aufwachsen, in der Vielfalt als Stärke gefeiert wird und in der jeder Mensch die gleichen Chancen hat.
Grenzüberschreitungen und fehlende Einsicht: Wenn vermeintliche Harmlosigkeit zur Belastung wird
Auch Sabine Freese, Pflegemutter des schwarzen Jungen Noah, erlebt immer wieder Situationen, in denen Menschen unbedacht Grenzen überschreiten. Das ungefragte Streicheln über Noahs krause Haare, weil man diese „tollen Locken“ einmal anfassen will, ist für sie ein klarer Fall von Grenzüberschreitung. Doch anstatt Einsicht und Entschuldigung erntet sie oft Unverständnis und Ablehnung. Um sich vor solchen Übergriffen zu schützen, hat Noah eine eigene Strategie entwickelt: Sobald Erwachsene auf ihn zukommen, ruft er laut: „Ok, du darfst!“ So behält er die Kontrolle über seinen Körper und entscheidet selbst, wer ihn berühren darf.
Die Welt können wir nicht für unsere Kinder ändern. Wir können sie nur darauf vorbereiten und sie stark machen.
Diese Episode zeigt auf erschreckende Weise, wie früh Kinder lernen müssen, sich vor Diskriminierung zu schützen. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich selbstbewusst und selbstbestimmt zur Wehr zu setzen. Wir müssen ihnen vermitteln, dass sie das Recht haben, Grenzen zu setzen und dass ihre Gefühle und Bedürfnisse wichtig sind. Gleichzeitig müssen wir uns dafür einsetzen, dass unsere Kinder in einer Umgebung aufwachsen, in der ihre Einzigartigkeit geschätzt wird und in der sie sich sicher und geborgen fühlen können.
Stereotypen als subtile Form des Rassismus: Wenn Schubladen das Denken bestimmen
Rassismus beschränkt sich nicht nur auf offene Beleidigungen und Grenzüberschreitungen. Auch tiefsitzende Stereotypen können eine Form von Alltagsdiskriminierung darstellen. Kinder, die durch ihre Hautfarbe oder ihre nicht-europäischen Gesichtszüge auffallen, leiden oft unter Vorurteilen wie: „Alle Asiaten essen gerne Reis, haben Schlitzaugen und können Karate“, oder „Alle Afrikaner sind extrem sportlich, haben den Rhythmus im Blut und sprechen schlecht Deutsch“. Nina Hoffmann, Mutter des siebenjährigen Simon, erinnert sich noch gut an den Tag, als sie ihren zweijährigen Sohn bei der Tagesmutter abholte und er ihr mit einer Trommel entgegenkam. Die Erzieherin war der Meinung, dass das Kind entsprechend seiner halb-afrikanischen Wurzeln gefördert werden müsse und hatte ihm das Instrument gekauft. Simon hasste Musik.
Auch wenn solche Handlungen gut gemeint sein mögen, so offenbaren sie doch eine tief verwurzelte Vorstellung davon, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen müssten. Es ist wichtig, dass wir uns dieser Stereotypen bewusst werden und unsere Kinder dazu ermutigen, Menschen als Individuen wahrzunehmen und sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen. Nur so können wir eine Gesellschaft schaffen, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial zu entfalten, unabhängig von seiner Herkunft oder seinem Aussehen.
Gemeinsam stark: Wie Eltern und Erzieher Kinder gegen Rassismus stärken können
Eltern können ihre Kinder nicht alleine stark machen. Es braucht Erzieher und Lehrer, die sensibel auf Alltagsdiskriminierungen reagieren und nicht wegschauen, wenn auf deutschen Schulhöfen rassistische Parolen gebrüllt werden. Es sei auch ihre Aufgabe, immer wieder deutlich zu machen, dass an dieser Schule, in dieser Kita niemand ausgelacht wird, weil er eine andere Hautfarbe, krause Haare oder eine andere Religion hat, findet Nina Hoffmann. Wenn sich etwas ändern soll, muss das schon in der Kita passieren, ist sich auch Thanh sicher. „Haben die Kinder erstmal ‚Ching, chang, chong‘ statt ‚Schnick, schnack, schnuck‘ gespielt, ist es in den Köpfen. Sind sie dann älter, werden sie den Spruch hemmungslos nutzen, um Asiaten zu mobben.“
Um unsere Kinder bestmöglich zu unterstützen, ist es entscheidend, dass wir als Mütter eng mit den Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Wir können uns aktiv in Elterngremien einbringen, an Fortbildungen zum Thema Diversität teilnehmen und den Dialog mit Erziehern und Lehrern suchen. Gemeinsam können wir Strategien entwickeln, um Rassismus in der Schule und Kita zu bekämpfen und eine inklusive Lernumgebung zu schaffen, in der sich alle Kinder wohl und akzeptiert fühlen.
Es ist auch wichtig, dass wir unseren Kindern ein gutes Vorbild sind und selbst aktiv gegen Rassismus eintreten. Wir können uns in unserer Gemeinde engagieren, Organisationen unterstützen, die sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen, und uns öffentlich gegen Diskriminierung aussprechen. Indem wir Haltung zeigen, vermitteln wir unseren Kindern wichtige Werte und zeigen ihnen, dass sie selbst einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten können.
Die Last der Ausgrenzung: Wie sich Rassismus auf die betroffenen Kinder auswirkt
Spätestens nach der Grundschulzeit verschwindet oft der Niedlichkeitsbonus, und die rassistischen Beschimpfungen nehmen noch zu. Es stauen sich Wut und Hilflosigkeit. Nicht immer und nicht bei jedem klappt das mit dem Durchzug. „Ich wehre mich immer nur mit halber Kraft“, erzählt Kim. „Sonst bekomme ich noch mehr Stress. Früher hab‘ ich mir zusammen mit meinen Eltern Sprüche überlegt, mit denen ich zurückdissen kann: ‚Halt die Klappe, Käsekuchen‘! Oder ‚Schade, dass du nicht weißt, wo Kambodscha liegt‘“. Das habe aber auf die Dauer auch nichts geändert. Wie die Eltern jetzt helfen? „Ich erzähl zu Hause nicht alles. Mama regt sich dann nur auf und rennt zum Direktor. Dann steh‘ ich als Opfer da und die Mobber haben keinen Respekt mehr vor mir“, beschreibt er sein Dilemma. „Irgendwann“, prophezeit Kim, „läuft meine Geduld über. Und dann werden die sich wundern!“
Die Worte von Kim sind ein Weckruf für uns alle. Sie zeigen, wie wichtig es ist, den betroffenen Kindern zuzuhören und ihre Gefühle ernst zu nehmen. Wir müssen ihnen einen sicheren Raum bieten, in dem sie sich öffnen und über ihre Erfahrungen sprechen können, ohne Angst vor Verurteilung oder Ablehnung haben zu müssen. Gleichzeitig müssen wir ihnen helfen, Strategien zu entwickeln, um mit Rassismus umzugehen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Es ist unsere Pflicht, ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass wir an ihrer Seite stehen, um für eine gerechtere Welt zu kämpfen.
- „Du siehst ja aus wie Schokolade!“
- „Hey, Sushi!“
- „Schlitzauge!“
- „Du Flüchtling!“
Fazit: Gemeinsam für eine Zukunft ohne Rassismus
Rassismus in Kita und Schule ist eine Realität, die wir nicht länger ignorieren dürfen. Die Geschichten von Kim, Thanh, Noah und Simon zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund noch immer mit Vorurteilen, Beleidigungen und Ausgrenzung zu kämpfen haben. Es ist unsere Verantwortung als Mütter, Erziehungsberechtigte und Mitglieder der Gesellschaft, aktiv gegen Rassismus einzutreten und eine inklusive Umgebung zu schaffen, in der sich alle Kinder wohl und akzeptiert fühlen.
Wir müssen uns unserer eigenen Vorurteile bewusst werden, Stereotypen hinterfragen und offen über Rassismus sprechen. Wir müssen unsere Kinder ermutigen, Vielfalt als Bereicherung zu sehen und sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Gemeinsam mit Erziehern und Lehrern können wir Strategien entwickeln, um Rassismus in Bildungseinrichtungen zu bekämpfen und eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts zu fördern. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Kinder in einer Zukunft aufwachsen, in der Rassismus keinen Platz hat.
Eltern.de