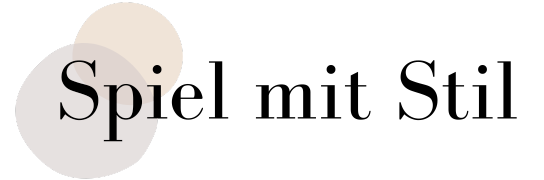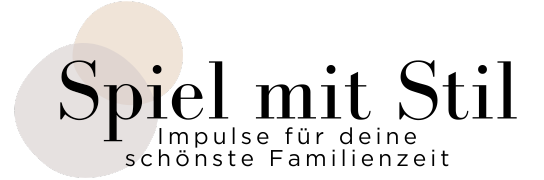Es ist ein Satz, der Mütter in Rage versetzt, der unterschwellig Vorwürfe transportiert und der so oft fällt, wenn es um neue Empfehlungen und Erkenntnisse in der Kindererziehung geht: „Wie haben wir früher nur überlebt?“
Der unterschwellige Vorwurf
Stellen Sie sich vor: Sie sitzen mit anderen Eltern in einem Raum, vielleicht bei einem Elternabend im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe. Eine Erzieherin erklärt, dass Weintrauben für kleine Kinder nur halbiert oder geviertelt in die Brotdose gehören, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Sofort ist er da, dieser Gedanke: „Das hatten wir früher doch auch nicht!“ Und vielleicht wird er sogar ausgesprochen, begleitet von einem abfälligen Unterton, der suggeriert, dass die heutigen Eltern einfach übertreiben.
Dieser Satz, diese Haltung, sie nervt. Sie nervt, weil sie Fortschritt negiert, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und weil sie Eltern, die sich informieren und ihr Verhalten anpassen, als überfürsorglich abstempelt. Es ist ein Reflex, eine Abwehrhaltung gegenüber allem Neuen, die sich oft in Kommentaren in sozialen Medien, auf Elternabenden oder einfach im Gespräch mit anderen Müttern und Vätern zeigt. Doch woher kommt diese Vehemenz, mit der sich manche gegen Veränderungen und neue Empfehlungen sträuben?
Ist es eine Kränkung, weil das, was man selbst einst als richtig erachtete, nun infrage gestellt wird? Ist es die Angst, etwas falsch gemacht zu haben? Oder ist es einfach nur der Versuch, die eigenen Entscheidungen zu rechtfertigen, ohne dass überhaupt jemand eine Rechtfertigung gefordert hätte? Fakt ist, dass Empfehlungen und Denkanstöße nicht als Kritik, sondern als Chance zur Verbesserung verstanden werden sollten. Niemand schreibt Eltern vor, was sie zu tun haben. Es geht vielmehr darum, Wissen weiterzugeben und voneinander zu lernen.
Die Sache mit den Weintrauben
Es ist ein simples Beispiel, aber es verdeutlicht das Problem: Weintrauben, die im Ganzen verschluckt werden, können bei Kleinkindern leicht in der Luftröhre stecken bleiben und zu Erstickung führen. Das ist eine Tatsache, die durch Studien belegt ist. Warum also sollte man dieses Risiko eingehen, wenn es so einfach vermieden werden kann? Natürlich sind früher auch Kinder groß geworden, ohne dass die Weintrauben halbiert wurden. Aber einige eben auch nicht. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das Leben unserer Kinder sicherer zu machen, sollten wir diese Chance doch nutzen.
Ich erinnere mich an eine Situation, als mein Sohn klein war und ich ihm unbedarft eine Handvoll Weintrauben in die Hand drückte. Eine andere Mutter wies mich darauf hin, dass ganze Weintrauben gefährlich sein können. Zuerst war ich kurz irritiert, aber dann dankbar. Ich hatte es einfach nicht besser gewusst. Hätte ich mich angegriffen fühlen sollen? Nein, denn es ging nicht um Schuldzuweisungen, sondern um den Austausch von Informationen. Und genau das sollte im Mittelpunkt stehen: Ein offener und respektvoller Dialog zwischen Eltern, bei dem jeder von jedem lernen kann.
Das bloße Überleben unserer Kinder darf nicht der Maßstab sein. Wir sollten uns bemühen, ihnen eine sichere, gesunde und glückliche Kindheit zu ermöglichen.
Früher war nicht alles besser
Der Satz „Wie haben wir früher nur überlebt?“ blendet oft die Realität aus. Er ignoriert, dass viele Empfehlungen und Ratschläge auf schmerzhaften Erfahrungen und tragischen Unfällen beruhen. Früher starben Kinder im Auto, weil sie nicht angeschnallt waren. Heute sterben weniger Kinder bei Autounfällen, weil wir gelernt haben, dass ein Sicherheitsgurt Leben retten kann. Früher wurden Babys ohne Narkose operiert, weil man annahm, sie würden keinen Schmerz empfinden. Heute wissen wir es besser und handeln entsprechend.
Diese Fortschritte sind nicht selbstverständlich. Sie sind das Ergebnis von Forschung, Erfahrung und gesellschaftlichem Wandel. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir als Gesellschaft dazulernen und uns weiterentwickeln. Warum also sollten wir uns diesem Fortschritt verschließen und an alten Gewohnheiten festhalten, nur weil „es früher auch ging“?
Es geht nicht darum, Kinder in Watte zu packen oder sie vor jedem Risiko zu bewahren. Es geht darum, unnötige Gefahren zu vermeiden und ihnen ein möglichst sicheres Umfeld zu bieten, in dem sie sich entfalten können. Und das bedeutet eben auch, sich über neue Erkenntnisse zu informieren und das eigene Handeln gegebenenfalls anzupassen.

Früher war alles besser? Ein nostalgisches Stillleben regt zum Nachdenken über alte und neue Erziehungsmethoden an.
Der Balanceakt
Natürlich gibt es auch Eltern, die es mit der Fürsorge übertreiben und ihre Kinder überbehüten. Aber das ist nicht die Regel. Die meisten Eltern wollen einfach nur das Beste für ihre Kinder und sind bereit, sich zu informieren und ihr Verhalten anzupassen, wenn es nötig ist. Es ist ein Balanceakt zwischen dem Schutz der Kinder und der Förderung ihrer Selbstständigkeit. Und dieser Balanceakt gelingt nicht immer perfekt. Aber solange wir uns bemühen und voneinander lernen, sind wir auf dem richtigen Weg.
Am Ende des Tages muss jede Familie ihren eigenen Weg finden. Es gibt nicht die eine richtige Art, Kinder zu erziehen. Was für die eine Familie funktioniert, muss für die andere noch lange nicht passen. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig respektieren und unterstützen, anstatt uns zu verurteilen und zu kritisieren. Denn Elternsein ist schon schwer genug. Da brauchen wir nicht noch zusätzlichen Druck von außen.
Lasst uns voneinander lernen
Anstatt also den Satz „Wie haben wir früher nur überlebt?“ zu bemühen, sollten wir uns lieber fragen: Was können wir heute besser machen? Welche neuen Erkenntnisse gibt es, die uns helfen können, unsere Kinder sicherer, gesünder und glücklicher aufzuziehen? Lasst uns offen sein für Neues, lasst uns voneinander lernen und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die bestmögliche Kindheit für unsere Kinder zu gestalten. Denn das ist es doch, was wir alle wollen, oder?
Eine offene Kommunikation und der Austausch von Erfahrungen sind entscheidend. Hören wir einander zu, ohne zu urteilen. Seien wir bereit, unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Und vor allem: Erinnern wir uns daran, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wir alle wollen nur das Beste für unsere Kinder. Und gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen.
Fazit
Der Satz „Wie haben wir früher nur überlebt?“ ist mehr als nur eine harmlose Bemerkung. Er ist Ausdruck einer Abwehrhaltung gegenüber Fortschritt und neuen Erkenntnissen in der Kindererziehung. Anstatt uns diesem Fortschritt zu verschließen, sollten wir ihn als Chance begreifen, das Leben unserer Kinder sicherer, gesünder und glücklicher zu gestalten. Lasst uns voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam daran arbeiten, die bestmögliche Kindheit für unsere Kinder zu schaffen.
Eltern.de