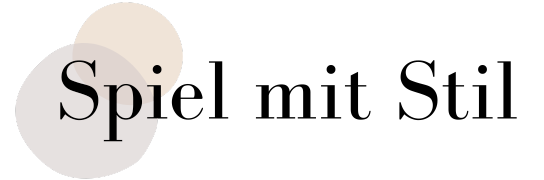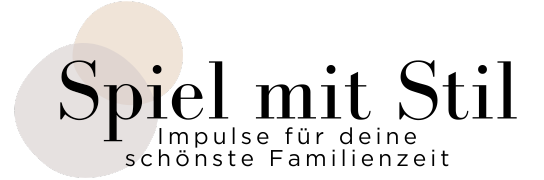Es ist ein sonniger Nachmittag im Park. Kinder lachen, rennen und spielen. Doch inmitten des fröhlichen Treibens entbrennt ein kleiner Streit. Zwei kleine Jungen zerren an demselben roten Feuerwehrauto. „Meins!“, schreit der eine. „Nein, meins!“, entgegnet der andere. Die Mütter eilen herbei, versuchen zu schlichten, zu erklären, dass Teilen doch so wichtig sei. Aber die Kleinen sind stur. Kennen wir das nicht alle? Das Thema Teilen ist ein Dauerbrenner in Familien mit Kindern. Es beginnt im Sandkasten und zieht sich bis ins Teenageralter. Doch warum fällt es unseren Kindern eigentlich so schwer, abzugeben, zu teilen, zu kooperieren?
Die „Meins!“-Phase: Warum Teilen im Kindergartenalter so schwerfällt
Die Trotzphase ist berüchtigt, aber die „Meins!“-Phase, die oft parallel verläuft, kann Eltern ebenso zur Verzweiflung treiben. Es ist völlig normal, dass Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren eine starke Besitzorientierung entwickeln. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist das sogar wichtig. In diesem Alter lernen Kinder, sich als eigenständige Individuen zu begreifen. Sie entwickeln ein Gefühl für ihr Eigentum und die Fähigkeit, „meins“ von „deins“ zu unterscheiden. Das ist ein wichtiger Schritt zur Ich-Findung. Die Welt aus Kinderaugen ist eben anders als aus Erwachsenensicht. Was für uns selbstverständlich erscheint – das Teilen von Ressourcen, das Abgeben von Dingen – ist für ein Kind im Kindergartenalter eine echte Herausforderung. Es geht nicht darum, dass sie nicht wollen; sie können oft einfach noch nicht. Sie müssen erst lernen, die Perspektive anderer zu verstehen, ihre eigenen Impulse zu kontrollieren und darauf zu vertrauen, dass sie das, was sie hergeben, auch wieder zurückbekommen.
Stell dir vor, du bist drei Jahre alt und dein Lieblingsspielzeug, der rote Bagger, ist das Wertvollste, was du besitzt. Plötzlich kommt da ein anderes Kind und will ihn haben. Für dich bedeutet das: Verlust, Unsicherheit, vielleicht sogar Angst. Angst davor, dass das andere Kind deinen Bagger kaputt macht, ihn nicht wieder hergibt oder ihn einfach besser findet als du. In diesem Moment ist es schwer, die Perspektive des anderen Kindes einzunehmen und zu verstehen, dass auch Klaas-Ole einfach nur Spaß haben will. Es braucht Zeit und Geduld, bis Kinder lernen, diese Gefühle zu regulieren und eine faire Lösung zu finden.

Gemeinsam spielen: Wie Kinder das Teilen lernen
Strategien für entspanntere Konfliktsituationen
Anstatt also von unseren Kleinsten zu erwarten, dass sie von heute auf morgen zu selbstlosen Teilern werden, sollten wir sie auf diesem Weg begleiten. Es gibt einige Strategien, die sich im Alltag bewährt haben, um Konfliktsituationen zu entschärfen und das Teilen zu fördern:
- Vorbild sein: Kinder lernen durch Nachahmung. Wenn sie sehen, dass wir selbst teilen – sei es das Stück Kuchen mit dem Partner oder die Aufmerksamkeit zwischen den Kindern – verinnerlichen sie diese Werte.
- Nicht erzwingen: Zwang führt oft zu Trotz und Widerstand. Stattdessen sollten wir versuchen, das Teilen spielerisch und positiv zu gestalten.
- Alternativen anbieten: Wenn zwei Kinder um dasselbe Spielzeug streiten, können wir ihnen Alternativen anbieten. „Schau mal, hier ist noch ein Bagger. Oder ihr könnt zusammen die Burg bauen.“
- Zeitliche Begrenzung: Eine klare Zeitbegrenzung kann helfen, Konflikte zu vermeiden. „Klaas-Ole darf jetzt fünf Minuten mit dem Bagger spielen, danach bist du wieder dran.“
- Gefühle anerkennen: Es ist wichtig, die Gefühle der Kinder ernst zu nehmen. „Ich verstehe, dass du traurig bist, weil du den Bagger abgeben musst. Aber Klaas-Ole freut sich auch schon darauf.“
Indem wir diese Strategien anwenden, schaffen wir eine Atmosphäre, in der Kinder sich sicher und verstanden fühlen. Sie lernen, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, aber auch die der anderen. Und das ist die Grundlage für echtes Teilen.
Das Teenageralter: Tauschen, Netzwerken und soziale Anerkennung
Mit dem Eintritt in die Pubertät verändert sich auch die Bedeutung des Teilens. Es geht nicht mehr nur um Spielzeug und Süßigkeiten, sondern um soziale Beziehungen, Anerkennung und Zugehörigkeit. Teenager tauschen Erfahrungen, Wissen, materielle Güter und sogar ihre Zeit, um ihren Platz in der Gruppe zu festigen. Das Teilen wird zum Instrument der sozialen Interaktion.
Erinnern wir uns an Frieda, 13 Jahre alt, die ihre alten Handyhüllen ihrer besten Freundin Mascha schenkt. Für ihren Vater mag das unvernünftig erscheinen, aber für Frieda ist es eine Investition in ihre Freundschaft. Sie tauscht materielle Güter gegen soziale Anerkennung und die Gewissheit, dass Mascha sie bald wieder zum Reiten mitnimmt. Es ist eine Art des Netzwerkens, die in diesem Alter eine große Rolle spielt. Teenager sind ständig auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Sie experimentieren mit verschiedenen Identitäten, probieren neue Hobbys aus und knüpfen Kontakte. Das Teilen ist ein Weg, um sich auszuprobieren, Freundschaften zu schließen und die eigene Position in der sozialen Hierarchie zu stärken.
„Kinder starten ins Leben mit der Veranlagung, teilen und kooperieren zu wollen. Dazu müssen wir sie nicht erziehen. Im Lauf der Zeit lernen sie jedoch, genauer auszuwählen, wem sie helfen und mit wem sie teilen wollen – und dabei spielen positive wie negative Rückmeldungen aus ihrem Umfeld eine wichtige Rolle.“
Diese Aussage von Dr. Michael Tomasello, ehemaliger Leiter des Leipziger Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie, unterstreicht die natürliche Bereitschaft von Kindern zum Teilen. Es ist nicht unsere Aufgabe, ihnen das Teilen aufzuzwingen, sondern sie dabei zu unterstützen, diese Fähigkeit weiterzuentwickeln und zu verfeinern.
Auch der digitale Raum spielt eine immer größere Rolle im Leben von Teenagern. Sie teilen Wissen über WhatsApp-Gruppen, helfen sich gegenseitig bei den Hausaufgaben und tauschen sich über ihre Interessen aus. Studien zeigen sogar, dass diese Form der digitalen Lernunterstützung einen positiven Einfluss auf den Schulerfolg haben kann. Es ist also wichtig, dass wir als Eltern offen bleiben für die neuen Formen des Teilens und unseren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Medien vermitteln.
Kompromisse finden: Privatsphäre und Gastfreundschaft im Teenageralter
Ein weiteres Streitthema im Teenageralter ist oft die Frage nach der Gastfreundschaft. Teenager wünschen sich ein offenes Haus, in dem ihre Freunde willkommen sind. Sie wollen freie Kühlschranknutzung, ungehinderten Zugang zum WLAN und vielleicht sogar ein eigenes Gästeklo. Für Eltern kann das eine Herausforderung sein. Sie haben ein Bedürfnis nach Privatsphäre und wollen nicht, dass das eigene Zuhause zum Selbstbedienungsladen für die Freunde des Kindes wird.
Die Lösung liegt auch hier in Kompromissen. Ein großzügiger Snack-Vorrat in der Speisekammer, ein Gäste-Zugang fürs WLAN und klare Regeln für den Umgang mit dem Eigentum anderer können helfen, die Wogen zu glätten. Wichtig ist, dass beide Seiten ihre Bedürfnisse äußern und gemeinsam nach einer Lösung suchen, mit der alle leben können.
Fazit: Teilen lernen als lebenslanger Prozess
Teilen lernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist ein lebenslanger Prozess, der von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter andauert. Als Eltern können wir unsere Kinder auf diesem Weg begleiten, indem wir ihnen ein gutes Vorbild sind, ihre Gefühle ernst nehmen, Kompromisse eingehen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln. Wir sollten uns bewusst machen, dass das Teilen nicht immer einfach ist und dass es Zeiten geben wird, in denen unsere Kinder nicht teilen wollen oder können. Aber wenn wir ihnen mit Geduld, Liebe und Verständnis begegnen, werden sie lernen, dass Teilen nicht nur eine soziale Fähigkeit ist, sondern auch eine Quelle von Freude, Freundschaft und sozialer Anerkennung.
Indem wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln, lernen sie, dass Teilen nicht nur eine soziale Fähigkeit ist, sondern auch eine Quelle von Freude, Freundschaft und sozialer Anerkennung. So entwickeln sie sich zu verantwortungsbewussten und empathischen Menschen, die bereit sind, mit anderen zu teilen und zusammenzuarbeiten.
Eltern.de