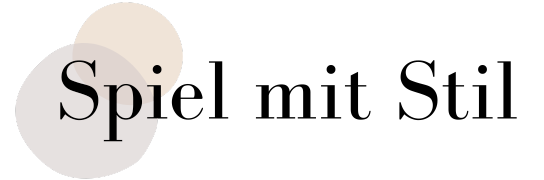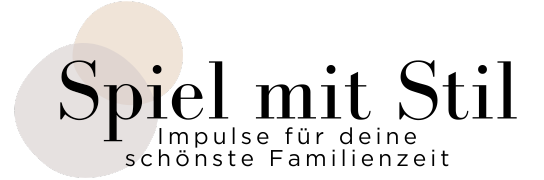Die Pubertät – eine Zeit des Umbruchs, der Herausforderungen und der großen Veränderungen. Nicht nur für die Teenager selbst, sondern auch für die Eltern. Plötzlich scheint alles, was gestern noch galt, über den Haufen geworfen. Regeln werden hinterfragt, Zärtlichkeiten als peinlich abgetan und die einst so geliebten Eltern zu Fremdkörpern im eigenen Leben. Doch keine Panik, liebe Mamas! Diese Phase ist zwar turbulent, aber auch voller Chancen, die Beziehung zu Ihrem Kind neu zu definieren und es auf dem Weg zum Erwachsenwerden bestmöglich zu begleiten.
Teenager verstehen: Die wichtigsten Regeln für eine harmonische Pubertät
Die Pubertät ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sowohl für die Jugendlichen als auch für die Eltern. Es ist eine Zeit, in der sich die Kinder von ihren Eltern abnabeln und ihren eigenen Weg suchen. Dies kann zu Konflikten und Missverständnissen führen. Doch mit den richtigen Strategien können Eltern ihren Teenagern helfen, diese schwierige Phase zu meistern und gleichzeitig die Beziehung zu ihnen zu stärken. Es geht darum, loszulassen, ohne den Kontakt zu verlieren, und Halt zu geben, ohne einzuengen.
Als Mutter ist es wichtig zu verstehen, dass Ihr Teenager in dieser Zeit viele Veränderungen durchmacht. Körperliche Veränderungen, hormonelle Schwankungen und der Druck, sich in der Peergroup zu behaupten, können zu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und Unsicherheit führen. Versuchen Sie, geduldig und verständnisvoll zu sein, auch wenn es schwerfällt. Hören Sie Ihrem Kind zu, nehmen Sie seine Gefühle ernst und bieten Sie ihm Ihre Unterstützung an. Dabei ist es wichtig, die Balance zu finden zwischen Nähe und Distanz, zwischen Kontrolle und Freiheit. Ihr Teenager braucht Freiraum, um sich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln, aber auch die Gewissheit, dass Sie für ihn da sind, wenn er Sie braucht.
Lob und Anerkennung: Der Treibstoff für ein starkes Selbstbewusstsein
„Das hast du gut gemacht!“ – ein Satz, der so einfach ist und doch so viel bewirken kann. Teenager brauchen Lob und Anerkennung, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sich selbst wertzuschätzen. Ohne Wertschätzung fühlen sie sich unsicher, unglücklich und verbittert. Ein ehrliches Lob kann über Hürden hinweghelfen, das Selbstvertrauen stärken und zu neuen Höchstleistungen motivieren. Aber Vorsicht: Lob sollte nicht inflationär und unüberlegt eingesetzt werden. Es muss ehrlich gemeint sein und von Herzen kommen. Sonst verliert es seine Wirkung und kann sogar kontraproduktiv sein.
Motivationsforscher Reinhard K. Sprenger warnt davor, Lob als „Fast-Food-Zuwendung der Zeitmangel-Generation“ zu missbrauchen. Stattdessen sollte Lob gezielt und differenziert eingesetzt werden. Hat Ihr Kind den Tisch gedeckt, einen guten Schulabschluss hingelegt oder ein Fußballspiel gewonnen? Das sind alles unterschiedliche Anlässe, die auch unterschiedlich gewürdigt werden sollten. Wer immer nur gleichbleibend „Das hast du toll gemacht“ sagt, erreicht damit das Gegenteil. Lob kann sogar Neugier und Interesse lähmen, wenn Leistung nur noch aus Berechnung, also für die Belohnung, erbracht wird. Studien haben gezeigt, dass Kinder, die ohne Aussicht auf Belohnung eine Aufgabe übernehmen, sie oft besser verrichten als Kinder, die dafür belohnt werden. Denn die verlieren bald das Interesse und bringen insgesamt geringere Leistungen, weil sie die Tätigkeit nicht an sich für wichtig halten, sondern weil die Belohnung den Sinn ersetzt.

Erwachsen werden – Zehn Regeln für die Pubertät
Die Macht der Zärtlichkeit: Mehr als nur Worte
Viele Erwachsene denken, Teenager seien für elterliche Zärtlichkeiten schon zu groß. Doch das ist ein Irrtum. Körperliche Zärtlichkeiten sind für Kinder und Heranwachsende überlebenswichtig. Umarmungen können Wut, Kummer, Niedergeschlagenheit, Stress, Einsamkeit und Angst besiegen – oft besser als jedes tiefschürfende Gespräch. Liebe und Zärtlichkeit gehören zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Sie verbinden mit anderen Menschen und schaffen ein Zugehörigkeitsgefühl mit der Welt und dem Leben.
Es genügt nicht, seinem Kind einfach nur zu sagen: „Ich liebe dich“. Das muss es vielmehr unmittelbar und am eigenen Leib spüren können. Von klein auf. Der Anthropologe Ashley Montague bezeichnet die Haut als das wichtigste Organ neben dem Gehirn. Liebe erfährt ein Kind vor allem über die Haut, seinem größten Sinnesorgan. Eine feste Umarmung bewirkt, dass Endorphine, Glückshormone, ausgeschüttet werden, die innerhalb kürzester Zeit ihre beruhigende, schmerzstillende und aufheiternde Wirkung tun. Gleichzeitig sinkt das Stresshormon Cortisol. Ein Kind, das verängstigt oder verletzt in den Armen der Mutter Zuflucht sucht, tut also instinktiv das Richtige. Aber durch Umarmungen und Streicheln werden auch Immunfunktionen fester – und die fördern die Intelligenz. Streicheln und kuscheln stimmt aggressive und hyperaktive Kinder friedlich und traurige Kinder fröhlich. Bei Kindern, die viel geküsst und geknuddelt werden, zeigt sich eine deutlich verstärkte Aktivität in der linken frontalen Hirnhälfte – derjenigen, die für Freude und Heiterkeit zuständig ist.
Sicherheit und Selbstvertrauen gewinnen Kinder durch eine feste, verlässliche Beziehung an eine Vertrauensperson. Die berühmte amerikanische Ärztin und Psychotherapeutin Virginia Satir sagte einst, dass jeder Mensch zum Wachsen und Reifen „zwölf Umarmungen pro Tag“ braucht. Kinder leiden, wenn ihre Eltern nicht zärtlich sein können.
Eltern, die ihren Kindern in der Pubertät Halt geben, ohne sie einzuengen, legen den Grundstein für eine starke und liebevolle Beziehung, die ein Leben lang hält.
Hier die Keythesis: Eltern in der Pubertät ihrer Kinder sollten eine Balance finden zwischen Loslassen und Halt geben, zwischen Regeln und Freiräumen, zwischen Kontrolle und Vertrauen. Es geht darum, den Teenager auf seinem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten, ohne ihn zu bevormunden oder zu überbehüten.
Die Clique akzeptieren: Loslassen und Vertrauen schenken
Der Zusammenschluss von Kindern oder Teenagern in der Gang oder Clique hat in fast allen Fällen nichts mit Gewalt zu tun, sondern gehört zu einer normalen Entwicklung eines Heranwachsenden einfach dazu. Nachdem ein Kind gelernt hat, mit Einzelnen Freundschaft zu schließen, ist die Fähigkeit, sich einer Gruppe anzuschließen der zweite wichtige Pfeiler, auf dem Kinder gesunde soziale Beziehungen aufbauen müssen. Während es in Zweier-Freundschaften vorrangig darum geht, sich mitzuteilen, stärkt die Mitgliedschaft in einer Gruppe das Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl von Kindern. Dabei entwickeln sie meist ein intensives Loyalitätsgefühl, ob die Gruppe nun gemeinsam Fußball spielt oder bastelt. Im Verlauf der Jahre kommt ihr eine ähnlich starke soziale Bedeutung zu wie der Familie.
Nicht umsonst handeln die schönsten Kinderbücher und Filme von Banden: „Die rote Zora“, „Der Krieg der Knöpfe“, „Emil und die Detektive“, „Die kleinen Strolche“. Gewiss wird dabei manches verklärt. Doch ebenso gewiss ist, dass Kinder in ihrer Gang Gemeinschaft und Gemeinsinn erleben. Hier haben Kinder Gelegenheit, sich solidarisch und einfühlsam zu verhalten – und auch einmal kräftig danebenzuhauen. Denn Kinder lernen Grenzen über Grenzerfahrungen. Dafür brauchen sie Freiräume, wo auch einmal Gemeinheiten möglich sind, wo sie ihrer Lust am Kaputt-Machen und Ärgern, am Bestrafen und Bestraft-Werden nachgeben dürfen, ohne dass es gleich weit reichende Folgen hat. Eltern hingegen müssen akzeptieren, dass in der Gruppe der Gleichaltrigen andere Regeln herrschen als unter Erwachsenen.
Die Sorge, dass die Gang einen schlechten Einfluss auf die Kinder haben könnte, ist in fast allen Fällen unbegründet. Kinder geraten auf die schiefe Bahn, wenn ihr Elternhaus lieblos, desinteressiert und zerrüttet ist. Im Gegenteil: Oft schützt die Gruppe sogar den Teenager, weil er nicht mehr allein unterwegs ist.
Feste Regeln: Der Rahmen für ein selbstbestimmtes Leben
Eine Erziehung ohne Maßstäbe und Grenzen führt zu egoistischem Verhalten. Eine Familie ist ein lebendiger Organismus. Und der braucht zwar einen Schuss Chaos, aber auch Strukturen und Regeln, an die sich alle halten können. Denn nur dann können Kinder auch die wunderbare Kunst des Durchwurstelns und Improvisierens entwickeln. Ein gewisses Chaos ist ohnehin unvermeidlich, weil Kinder immer im Hier und Jetzt leben. Sie kümmert kein Gestern und kein Morgen, und erst nach vielen Jahren können sie auf Erfahrungen zurück greifen und dann hoffentlich auch vorausblickend planen und handeln. Aber bis es so weit ist, brauchen sie Regeln und Rituale, aber natürlich auch Großzügigkeit, Phantasie und Flexibilität.
Um all das lernen zu können, braucht es allerdings eine Familie mit Rückhalt. Die kanadische Erziehungswissenschaftlerin Barbara Coloroso schreibt: „Die Familie mit Rückhalt ist mit einem Rückgrat vergleichbar, sie ist fest und dennoch flexibel. Sie bietet die nötige Unterstützung, die Kindern ermöglicht, ihr einmaliges und wahres Selbst in vollem Umfang zu erkennen und zu erfahren.“ Doch dafür müssen Eltern auch ausreichend streng sein. „Gute Eltern geben ihren Kindern nicht alles, was sie wollen, und bringen ihnen Manieren bei.“ Das hat nicht etwa ein Erwachsener gesagt – das ist vielmehr das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Teenagern. Fast 70 Prozent aller Acht- bis 18-Jährigen wünschen sich Eltern, die Autorität und Vorbildcharakter haben.
Das tägliche Zusammenleben braucht Regeln, auch wenn manche von ihnen noch so banal scheinen. Zum Beispiel: Jeder sagt, wann er nach Hause kommen wird; jeder hat Respekt vor dem Eigentum des anderen; jedes Familienmitglied hat das Recht, eine gewisse Zeit am Tag ungestört zu sein. Nur so werden aus pubertierenden Heranwachsenden stabile Erwachsene mit Humor, Ausdauer und gesundem Menschenverstand.
Streiten dürfen: Konflikte als Chance zur Reife
Kinder streiten sich untereinander, sie streiten sich mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und mit ihren Lehrern, mit ihren Klassenkameraden und mit ihren Freunden. Das ist normal. Kinder müssen sich streiten. Streit ist für ihre persönliche Entwicklung und Reife ebenso wichtig wie Essen und Trinken und ein regelmäßiger Schulbesuch. Denn niemand kann immer nur lieb und nett sein. Allerdings: Kinder müssen schon lange vor dem Eintritt ins Schulalter gelernt haben, dass sie niemals mit einem Gegenstand schlagen dürfen, dass es verboten ist, jemanden an den Haaren zu reißen oder ihm den Finger in die Augen zu bohren. Doch wenn sich Geschwister streiten, sollten es die Eltern vermeiden, Partei zu ergreifen. Geben Sie lieber bei Streitereien jedem Kind Gelegenheit, seinen Standpunkt vorzutragen. Sagen Sie nichts zu den gegenseitigen Vorwürfen, und regen Sie die Kinder an, selbst eine Lösung für ihr Problem zu finden. Auch wenn ältere Kinder manchmal auf einen Schiedsspruch der Eltern drängen, auf eine Entscheidung, wer im Recht hat und wer im Unrecht ist – machen Sie sich nicht zum Richter!
Allerdings sieht es manchmal so aus, als ob einige Kinder und Jugendliche äußerst aggressiv reagieren. Viele Pädagogen sind mittlerweile der Ansicht, dass sich die Konflikte unter Teenagern mehren und weitaus häufiger als früher in einer Form ausgetragen werden, die das Maß des Erträglichen bei weitem überschreiten. Hinzu kommt, dass es im Fernsehen oder Kino kaum noch Filme gibt, in denen es nicht um handfeste Auseinandersetzungen geht. Angesichts dessen lernen Kinder Konfliktfähigkeit – und Friedfertigkeit – vor allem dann, wenn sie bei ihren Eltern miterleben, dass mal der eine, mal der andere zurück steckt. Dass Mütter und Väter über sich lachen können, nicht nachtragend sind und nicht ständig dem Partner die Verfehlungen der Vergangenheit an den Kopf werfen. Wenn sich Eltern streiten, sollten sie dabei stets fair bleiben, denn ein Kind beobachtet den Streit der Eltern ganz genau. Und bei größeren Auseinandersetzungen gehören Kinder ohnehin vor die Tür. Weil sie nämlich Angst bekommen – und bei der anschließenden Versöhnung in der Regel nicht mit von der Partie sind.
Bevormundung vermeiden: Autonomie fördern
Eltern wissen vieles besser als ihre halbwüchsigen Kinder. Aber das ist kein Argument dafür, die Kinder zu bevormunden. Verbote und blinder Gehorsam gehören in die pädagogische Mottenkiste. Alle Menschen haben den grundlegenden Wunsch, sich zumindest in einigen Lebensbereichen als Urheber der eigenen Handlungen zu fühlen und nicht weisungsgemäß, sondern selbstinitiiert zu handeln – und das gilt natürlich auch für Teenager. Befehle wie „Lass das!“ oder Seufzer wie „So geht das nicht!“ beraubt ein Kind dieses Urheber-Erlebnisses. Wenn durch ein lückenloses System von Regeln und Geboten die guten Taten vorgeschrieben sind, werden sie auf diese Weise eher gehindert als gefördert. Wenn alles Gute schon vorgeschrieben ist, weichen Jugendliche auf der Suche nach dem Urheber-Erlebnis auf infantiles oder destruktives Verhalten aus. Und: Wenn einem Kind ständig signalisiert wird „Du kannst das nicht“, führt das meistens geradewegs in eine Neurose.
Positiv gesprochen, stehen Kinder für ständige Überraschungen und spontane Veränderungen. Negativ gesehen, stehen sie für Chaos und blanke Anarchie. Eltern haben deshalb ein berechtigtes Bedürfnis, mit einer gewissen Regelmäßigkeit – mit Normen, Prinzipien und Ritualen – Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Doch Kinder wollen sich die Welt selbst aneignen und nicht nur in den ausgetretenen und vorgezeichneten Bahnen der Eltern voranschreiten.
Seinem Kind ein Regelwerk mit auf den Weg zu geben, schadet also nicht. Allerdings darf es nicht zu eng und zu starr sein. Aber angenehme Umgangsformen, eine verständliche Ausdrucksweise sowie die Eindämmung gewisser wildwüchsiger Impulse sollten schon sein. Manchmal müssen Teenager einfach zum Nachdenken angehalten werden: In diesem Alter funktioniert das noch nicht von allein. Deshalb sollten sich Eltern auch dafür interessieren, was ihr Kind für Beweggründe gehabt haben könnte, etwas zu tun. Der beste Weg für Kritik, ohne dass sie bevormundend wirkt: ein kurzes, persönliches Statement. Also nicht: „Das tut man nicht. Wie alt bist du eigentlich?“, sondern „Ich mag es nicht, wenn du am Tisch so herum gammelst.“
Aufklärung: Mehr als nur Sex
Kinder sind heute zwar mit Sicherheit besser aufgeklärt als ihre Großeltern, doch weiter gebracht hat sie das auch nicht. Die Gesellschaft hat Liebe und Sexualität in den vergangenen Jahren gründlich entzaubert; andererseits nehmen Teenager-Schwangerschaften weltweit zu, und die Anzahl der HIV-Infizierten steigt ebenfalls. Damit nicht genug. Mancher Teenager ist durch übergroße sexuelle Toleranz und Freizügigkeit bereits komplett desillusioniert. Natürlich soll die Uhr nicht zurückgedreht werden in Zeiten, wo es hieß, dass Mädchen „einen Ruf zu verlieren haben“ oder Jungen „möglichst viele Erfahrungen sammeln sollen“. Heute möchten Eltern ihre Kinder so aufklären, dass sie Sexualität und Liebe später einmal als schön und erfüllend erleben. Sie möchten ihm viel Wissen mitgeben, weil das der beste Schutz vor unguten Erfahrungen ist. Aber deswegen muss ein Neunjähriger noch lange nicht genau wissen, was SM bedeutet oder Oralsex ist. Damit kann er nämlich noch gar nicht umgehen.
Eltern sollten mit ihren Kindern wieder mehr von Gefühlen sprechen. Und dürfen auch nicht verschweigen, dass einem bei einer zu frühen oder unguten Erfahrung möglicherweise das Herz gebrochen werden kann. Denn jeden Tag nimmt sich in Deutschland ein Kind bzw. Jugendlicher das Leben. Nicht immer, aber sehr oft aus Liebeskummer. Deshalb müssen Teenager dringend darüber aufgeklärt werden, welche emotionalen Turbulenzen die Liebe auslösen kann. Und dass sich Geborgenheit und Sicherheit, wie sie notwendig wären, um damit zurecht zu kommen, 13- bis 15-Jährige nur in seltenen Fällen gegenseitig geben können.
Trotzdem muss ein Kind natürlich über bestimmte Dinge wie sexuellen Missbrauch Bescheid wissen. Reden Sie zudem öfter als einmal mit Jugendlichen über Verhütungsmittel, den Schutz vor Aids und Ähnliches. Denn manches gerät in Teenagerköpfen rasch wieder in Vergessenheit. Und wer Schwierigkeiten hat, über Sexualität zu sprechen, sollte sich an Kinder- und Frauenärzte wenden: Dort gibt es Aufklärungsgespräche.
Respekt vor Eigentum: Vorbild sein
Teenager neigen dazu, alles zu vereinnahmen. Aber es ist nicht mehr möglich, einem 13-Jährigen den Unterschied zwischen „Mein“ und „Dein“ beizubringen, ihm einen sorgsamen Umgang mit öffentlichem Eigentum abzuverlangen und ihm Verantwortungsgefühl gegenüber der Natur beizubringen. Solche Regeln müssen rechtzeitig ausgeben werden. Schon Fünfjährige können verstehen, dass Papier in den Mülleimer gehört und nicht auf die Wiese, dass Vaters Schreibtisch tabu ist und die Bücher der älteren Schwester ebenfalls. Doch Respekt vor fremdem Eigentum bekommt ein Kind am ehesten, wenn Eltern sein Eigentum ebenfalls respektieren.
Doch das kann manchmal schwierig werden. Denn was gehört einem Kind? Das ist selbst beim Spielzeug nicht immer eindeutig geklärt. Gehört die teure Autorennbahn wirklich dem Kind? Dann müssten Sie eigentlich auch akzeptieren, dass ihr Teenager sie gegen drei CDs seines Freundes getauscht hat. Tun Eltern das nicht, stiften sie nur Verwirrung. Schließlich sollte gelten: Geschenkt ist geschenkt. Egal, wie teuer das Geschenk nun war. Sind bei Fahrrädern oder Computer für einen Teenager größere Ausgaben unvermeidlich, sollte er sich daran beteiligen. Nur dann wird er diese Anschaffungen auch wertschätzen und sorgfältig behandeln.
Aber Eltern sollten sich möglichst nicht am Eigentum ihrer Kinder vergreifen. Wer etwas aus dem Besitz eines Teenagers wegwerfen oder gar verschenken will, sollte vorher fragen. Ebenso sollte fragen, wer sich etwas ausleihen will. Besonders weibliche Teenager vergessen das in punkto Kleidung gerne und müssen von Zeit zu Zeit daran erinnert werden. Und wer etwas ausgeliehen hat, muss es heil zurück geben. Falls das nicht mehr möglich ist – weil zum Beispiel der Pullover verloren ist oder der Rock ein Loch hat -, muss auch ein Teenager lernen, dass er Ersatz beschaffen muss.
Zuhören: Die Kunst der Kommunikation
Kinder hören nicht zu. Das Problem jedoch ist nur: Je öfter etwas gesagt werden muss, desto weniger wird es gehört. Rudolf Dreikurs rät in einem solchen Fall: Tritt nach der ersten Aufforderung keine Reaktion ein, müssen Taten folgen, nicht noch mehr Worte. Das Kind sollte man dann nicht mehr schicken, sondern gegenbenenfalls führen: in das unaufgeräumte Zimmer, zum überquellenden Mülleimer oder zu den unerledigten Hausaufgaben. Und dann entweder so lange verharren, bis die Arbeit erledigt ist – oder zumindest, bis damit begonnen wurde. Doch damit Kinder zuhören und verstehen können, brauchen sie Körpereinsatz – Augenkontakt, Berührungen, ein Lächeln -, da ihre Umgebung immer lauter wird.
Andererseits beschweren sich auch Heranwachsende oft, dass ihre Eltern ihnen nie richtig zuhören. Das jedoch passiert oft aus einem vermeintlich guten Willen heraus: Insbesondere Mütter plagt häufig das Gefühl, immer ein offenes Ohr haben zu müssen. Doch das Ergebnis ist dann oft nur, dass man, weil überfordert, nur noch mit halbem Ohr zuhört. Man tut so als ob, sucht aber währenddessen nach Socken, hängt die Wäsche auf oder telefoniert. Wenn ein Kind etwas will, sollten Eltern deutlich sagen, wenn sie gerade nicht zuhören können, weil sie keine Zeit haben oder abgelenkt sind. Aber sie sollten einen Zeitpunkt nennen, wann sie zuhören oder eine wichtige Antwort geben können. Also etwa zumindest das Wort „Gleich“ sagen, oder „Morgen“ – oder auch: „Ich muss erst ein, zwei Tage darüber nachdenken. Falls ich es vergesse, erinnere mich bitte daran.“
Allerdings verspüren Teenager zwar am dringendsten den Wunsch, sich mitzuteilen, haben gleichzeitig aber auch die größten Schwierigkeiten damit. Ihr turbulentes Gefühlsleben macht das In-Worte-Fassen nicht unbedingt leichter. Eltern sollten einem Teenager trotzdem möglichst nicht ins Wort fallen. Sätze wie „Red‘ mal anständig!“ oder „Ich weiß schon, was Du sagen willst!“ schaffen nur Verdruss. Einfach nur zuzuhören kann oft wichtiger sein, als Rat und Trost zu spenden. Wenn die Eltern zuhören, bekommt ein Teenager das Gefühl, dass seine Eltern seine Empfindungen verstehen wollen, dass sie ihn ernst nehmen – und das stärkt sein Selbstvertrauen und lässt seine sprachlichen und schriftlichen Fertigkeiten wachsen.
Gelassenheit bewahren: Perfektionismus adé
Eltern sind ihren Kindern lange haushoch überlegen. Und das ist auch gut so, denn sonst könnten sie nicht beschützt werden. Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Eltern ihre Sache richtig machen. Nicht zuletzt, weil Kinder ihre Eltern nachahmen – und das bekanntlich auch in Bezug auf Fehler. Doch mit spätestens elf, zwölf Jahren schlagen Kinder plötzlich immer häufiger kritische Töne an: Sie entdecken, dass ihre Eltern Schwächen haben und alles andere als perfekt sind.
Doch das Bedürfnis der Eltern, immer alles richtig machen zu wollen, ist tief in ihrer Natur verwurzelt. Groß ist die Angst der Eltern davor, einen Fehler zu machen. Entspricht ein Kind nicht den Anforderungen und Erwartungen, zeigt sich irgendwo – ob in der Schule oder in der Freizeit – eine Unregelmäßigkeit, wird unverzüglich eingegriffen, kontrolliert, reguliert, therapiert. Fehler oder Unvollkommenheiten auch einmal auszuhalten, zu dem eigenen Versagen oder dem seines Kindes zu stehen, gehört nicht gerade zu den Stärken unserer Gesellschaft – und erst spät merken viele Mütter und Väter, dass so manches vermeintliche Super-Elternpaar dieselben Schwierigkeiten und Probleme hat wie man selbst.
Untersuchungen zum Thema „Kindesmisshandlung“ haben deutlich gemacht: Eltern, die sich mit ihrem Kind „über-identifizieren“ und ständig bemüht sind, alles perfekt zu machen, neigen zu gefährlichen Kurzschlusshandlungen. Für Kinder ist es eine große Last, wenn Mutter oder Vater mit einem Unfehlbarkeitsanspruch auftreten. Perfekte Eltern lassen keinen Raum für Fehler und eigene Erfahrungen. Ein Leben lang thronen solche Eltern unsichtbar als unerreichbares Ideal über ihren Kindern. Denn Erwachsen zu werden heißt auch: die Unzulänglichkeiten und Fehler der Eltern zu erkennen und sie trotzdem zu lieben.
Ein sicheres, gutes Selbstkonzept entwickeln Eltern und Kinder nicht, wenn sie sich ständig unter Druck setzen, sondern wenn sie Fehler eingestehen, Schwächen und Hilfslosigkeit, gar ein Scheitern – und sich dann nicht beleidigt oder resigniert aus dem Staub machen. Wer über Fehler lachen kann, kann auch den Druck, wie er von unserer erfolgsorientierten Gesellschaft ausgeübt wird, leichter ertragen.
Fazit: Die Pubertät als Chance
Die Pubertät ist zweifellos eine herausfordernde Zeit für Eltern und Kinder. Doch mit den richtigen Strategien und einer Portion Gelassenheit kann diese Phase auch eine Chance sein, die Beziehung zu Ihrem Kind zu vertiefen und es auf dem Weg zum Erwachsenwerden bestmöglich zu unterstützen. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Teenager mit Respekt, Wertschätzung und Verständnis begegnen. Hören Sie ihm zu, nehmen Sie seine Gefühle ernst und bieten Sie ihm Ihre Unterstützung an. Geben Sie ihm Freiraum, um sich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln, aber auch die Gewissheit, dass Sie für ihn da sind, wenn er Sie braucht. Akzeptieren Sie seine Clique, respektieren Sie sein Eigentum und vermeiden Sie Bevormundung. Setzen Sie klare Regeln und Grenzen, aber seien Sie auch bereit, Kompromisse einzugehen. Und vor allem: Bewahren Sie Ihre Gelassenheit und Ihren Humor. Denn die Pubertät ist nur eine Phase – und sie geht vorbei. Am Ende werden Sie stolz auf Ihren Teenager sein, der sich zu einem selbstbewussten, verantwortungsvollen und liebenswerten Erwachsenen entwickelt hat.
Hier nochmal die wichtigsten Regeln im Überblick:
- Teenager brauchen Lob! – Aber in Maßen
- Teenager brauchen Zärtlichkeit!
- Akzeptieren Sie die Clique Ihres Teenagers!
- Teenager brauchen feste Regeln!
- Teenager müssen sich streiten dürfen!
- Bevormunden Sie Ihren Teenager nicht!
- Reden Sie nicht nur über Sex, sondern auch über Gefühle!
- Respektieren Sie das Eigentum Ihres Teenagers!
- Hören Sie Ihrem Kind zu!
- Seien Sie gelassen!
Eltern.de